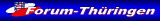Gastli - Texte und natürlich linksbündig
Hallo geschätzter Leser. Hier findet Ihr Texte einfach zu lang für jedes Forum, aber trotzdem lesenswert.
Meine Seite ist ab 18 Jahren, denn ab da kann man voraussetzen, dass der Mensch denkt...
...und ausserdem nicht mehr mit den Umtrieben der Deutschen Regierung gegen Websiten in Schwierigkeiten kommt, wenn er eine Internetseite wie diese lesen will.
Im Übrigen gilt Folgendes für die verlinkten Seiten:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten sind. Dieses kann – laut Landgerichtsurteil – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
So bleibt hier vorsorglich festzustellen, dass ich weder Einfluss auf die Gestaltung noch auf den Inhalt dieser gelinkten Seiten haben und uns auch nicht dafür verantwortlich zeichnen. Dies gilt für ALLE auf dieser Seite vorhandenen Links.
Gregor Gysi - Ende der Geschichte? Über die Chancen eines modernen Sozialismus
Der hier gedruckte Text folgt einem Vortrag, den der Autor am 24. Januar 2007 an der Universität Marburg gehalten hat.
Über Alternativen zum Kapitalismus in seiner heute vorherrschenden neoliberalen Ausprägung zu sprechen, tue ich als bekennender demokratischer Sozialist gern, weil ich ganz und gar nicht der Auffassung bin, dass wir an das »Ende der Geschichte« gelangt sind, wie das Francis Fukuyama nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus glauben machen wollte.
Das kann schon deshalb nicht stimmen, weil die Menschheit in ihrer Gesamtgeschichte zu 99 Prozent in nicht-kapitalistischen Gesellschaften lebte. Und weil der Kapitalismus selbst seit seiner Entstehung in der ursprünglichen Akkumulation im England des 15. und 16. Jahrhunderts oder noch früher, in den italienischen Städten des 13. Jahrhunderts, unterschiedliche soziale Formen, Kulturen und Entwicklungen angenommen hat und regelmäßig reformierbar war. Heute über den Sozialismus zu sprechen, fällt mir auch deshalb leicht, weil ich Anfang Januar bei der Amtseinführung des neuen Präsidenten Ecuadors, Rafael Correa, zugegen war und die Gelegenheit hatte, mit weiteren Staatspräsidenten und Vertretern anderer lateinamerikanischer Regierungen zu sprechen. Die Linksregierungen in Lateinamerika, von Bolivien über Venezuela, Brasilien, Chile, Argentinien, Uruguay bis hin zu Kuba, haben bei allen großen Unterschieden in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung und ihren Gesellschaften eines gemeinsam: Das neoliberale Projekt, das Milton Friedman bereits in den sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts proklamierte und sich weltweit durchzusetzen begann, besitzt in diesen Ländern keine gesellschaftliche Legitimation. Es ist dort gescheitert, zunächst bei den Mehrheiten der Bevölkerungen.
Aber eine Abkehr vom neoliberalen Zeitgeist können wir selbst auf unserem Kontinent beobachten. Die Slowakei galt als das Modellprojekt der Neoliberalen, dort existierte die so genannte flat tax, also ein einheitlicher Steuersatz von 19 Prozent für alle Bürgerinnen und Bürger, vom Millionär bis zur Verkäuferin. Die dort regierende konservativ-neoliberale Partei, einst mit 38 Prozent der Stimmen gewählt, erhielt bei den vergangenen Wahlen im Sommer des letzten Jahres nur noch 8 Prozent. Und es lohnt auch ein Blick auf unser Land. Schwarz-gelb wollten die Leute nicht, auch nicht das Steuermodell von Kirchhoff.
Und dank des Wahlerfolgs der Linkspartei wurde eine große Notkoalition gebildet, die zwar die neoliberale Politik der rot-grünen Schröder-Fischer-Regierung verschärft fortsetzt, aber mit deutlichen Abstrichen gemessen an dem, was sich Frau Merkel und Herr Westerwelle unter dem Eindruck guter Meinungsumfragen gemeinsam vorgenommen hatten. Außerdem gibt es neue Diskussionen im Bundestag, in den Medien und in der Gesellschaft.
Der Kapitalismus ist aus dem Feudalismus hervorgegangen, und seine ungeheure Dynamik stößt an seine sozialen und natürlichen Grenzen. Doch unsere Vorstellungskraft reicht zumeist nicht aus, sich eine Gesellschaft jenseits des Kapitalismus, so wie wir ihn kennen, mit seinen nivellierten Kulturen, seinen politischen Institutionen, der spezifischen Art und Weise der Produktion und Konsumtion vorzustellen.
Ich halte aber ebenso wenig von jenen Auffassungen auf linker Seite, die davon ausgehen, dass ihnen die Geschichte schon irgendwie Recht gäbe und der Kapitalismus an seinen inneren Widersprüchen und seiner Krisenanfälligkeit quasi gesetzmäßig keine Überlebenschancen habe. Das ist ahistorisch gedacht. Die Krisen, auch sehr tiefen Krisen des Kapitalismus in seiner Geschichte haben regelmäßig zu einer Transformation seiner Wirtschaft, Gesellschaften und Kulturen geführt. Der Kapitalismus hat sich als außerordentlich wandlungsfähig erwiesen. Antonio Gramsci bezeichnete diese Prozesse als »passive Revolution«, als die Anpassungsfähigkeit von ökonomischen und politischen Verhältnissen an die neuen historischen Herausforderungen. Der Kapitalismus erwies sich jedenfalls als weniger krisenanfällig als der gescheiterte Staatssozialismus. Zum Teil haben die Krisen, die der Kapitalismus in seiner jungen Geschichte durchlief, sogar zu seiner Stabilisierung beigetragen.
Eine Zusammenbruchstheorie, wie sie auch bei Rosa Luxemburg anklang, ist für mich kein Naturgesetz. Die Erlösung oder Überwindung kann nur aus den Gesellschaften selbst heraus und dort, wo Demokratie herrscht, nur auf demokratischem Wege erfolgen oder auch nicht. Rosa Luxemburgs und Friedrich Engels’ zugespitzte Alternative »Sozialismus oder Barbarei« gilt auch heute noch, vielleicht heute wieder mehr als in früheren Zeiten.
Moderne – Modernisierung
Ende der neunziger Jahre habe ich mich in »12 Thesen« schon einmal näher mit der Frage beschäftigt, wie eine Gesellschaft, die man als eine demokratische und sozialistische bezeichnen könnte, aussehen könnte, in der die Freiheit des Einzelnen die Bedingung der Freiheit aller Menschen ist – um mit der Vision von Marx und Engels zu sprechen.
Als systematischen Ausgangspunkt meiner Überlegungen wählte ich den Begriff der Moderne. Die Positionen, mit denen ich mich auseinandersetzen werde, sind deshalb auch Stellungnahmen zur Moderne und zu Modernisierungsprozessen. Das gilt für die Apologeten des Marktes ebenso wie für einen Teil der Linken.
Der Begriff der Modernisierung hat eine eigentümliche Doppelbedeutung. Mit ihm wird einmal der Prozess bezeichnet, in dem sich die Moderne aus der vormodernen Gesellschaft herausschälte, zugleich bezeichnet man mit ihm all die Prozesse der Entwertung der Vergangenheit und – komplementär dazu – der beständigen Neuerung, Prozesse also, die sich auch und insbesondere innerhalb der Moderne abspielen.
Die Moderne kann zunächst einmal als ein Epochenbegriff verstanden werden, der mit dem Beginn Neuzeit einsetzt. Als Großereignisse, die die Schwelle zur Neuzeit markierten, werden von den Historikerinnen und Historikern häufig die Renaissance, die Reformation und die Entdeckung der Neuen Welt benannt. Das freilich macht noch nicht klar, warum die so genannte Neuzeit auch wirklich eine neue Zeit war und ist.
In der Renaissance finden wir den Beginn eines politischen Denkens, das die Legitimität politischer Herrschaft nicht mehr aus religiösen Weltbildern ableitete, sondern die menschliche Vernunft als Legitimationsressource erschließt. Die Reformation andererseits gründete den Glauben nicht auf die zur Objektivität geronnene Autorität kirchlicher Institutionen, sondern betonte das subjektive Moment der Innerlichkeit. Damit leitete sie einen Prozess ein, an dessen Ende die Religion zur Privatangelegenheit wurde. Die Entdeckung Amerikas hingegen leitete durch die Kolonialisierung und die Ausbeutung der dortigen Edelmetallvorkommen die ersten Schübe der ökonomischen Modernisierung ein.
Es gehört nun aber zu den eigentümlichen Aspekten der Moderne, dass sie den Prozess der Ablösung von einer Vergangenheit, die Entwertung der Vorbild- und Orientierungsfunktion von Traditionen, der sie ihr Entstehen verdankte, stets aufs Neue wiederholt. Dafür kann man verschiedene Erklärungen bemühen. Zumindest für einen ökonomischen Zugang scheint die Darlegung von Marx und Engels aus dem Kommunistischen Manifest recht einleuchtend: »Die Bourgeoisie kann nicht existieren, ohne die Produktionsinstrumente, also die Produktionsverhältnisse, also sämtliche gesellschaftlichen Verhältnisse fortwährend zu revolutionieren. (...) Die fortwährende Umwälzung der Produktion, die ununterbrochene Erschütterung aller gesellschaftlichen Zustände, die ewige Unsicherheit und Bewegung zeichnet die Bourgeoisepoche vor allen früheren aus. Alle festen eingerosteten Verhältnisse mit ihrem Gefolge von altehrwürdigen Vorstellungen und Anschauungen werden aufgelöst, alle neugebildeten veralten, ehe sie verknöchern können. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht, und die Menschen sind endlich gezwungen, ihre Lebensstellung, ihre gegenseitigen Beziehungen mit nüchternen Augen anzusehen« (MEW Bd. 4, S. 465).
Aus dieser Perspektive ist es also die ökonomische Modernisierungsdynamik, die sich auf die Gesamtgesellschaft, einschließlich ihrer Kultur, auswirkt. Das kalkulatorische Interesse des Bourgeois, die moderne Form der Subjektivität, bildet den Boden der modernen Gesellschaft.
Allerdings war es bereits Hegel, der das Prinzip der »neuen Zeit« in der Subjektivität ausmacht. In den Gestaltungen der modernen Kultur (bei Hegel: des objektiven Geistes) sah er entsprechend viele Verkörperungen dieses Prinzips. Die objektivierenden Wissenschaften hatten die Welt entzaubert, und der subjektive Geist schrieb der objektivierten Natur die Gesetze vor; in Recht und Moral habe ein jedes sich als ein vor der Subjektivität zu Rechtfertigendes zu zeigen; in der romantischen Kunst schließlich sah Hegel die reine Innerlichkeit der Subjektivität thematisch werden.
Hegel war auch der erste, der den Modernisierungsprozess als Entwertungsprozess einst vorbildhafter Vergangenheit interpretierte. Die Kraft religiöser Autorität diente in vormodernen Gesellschaften als Quelle normativer Orientierung. Diese Quelle war zwar nicht versiegt, aber in ihrer fraglosen Autorität zumindest beschädigt. Die moderne Gesellschaft ist auf sich selbst zurückgeworfen, sie kann keine Vergangenheit mehr mobilisieren, um normative Orientierungen zu generieren.
Wenn man Moderne und Modernisierung so beschreibt, dann gibt es drei prinzipielle Einstellungen zu ihr:
Erstens: Der Prozess der Aufklärung wird als Emanzipationsprozess begrüßt. Er ist es auch in der Tat, denn menschliche Subjektivität wird aus dem autoritären Zwang der Traditionen entlassen.
Oder zweitens: Der Prozess der Aufklärung wird abgelehnt oder bedauert, da er die Orientierung stiftenden Funktionen der Tradition, insbesondere der Religion, zerstört.
Oder drittens: der Prozess der Aufklärung wird als Emanzipationsprozess anerkannt; zugleich jedoch wird der Akzent auf den »dunklen Fleck« der Aufklärung gelegt: nämlich dass sie Gefahr läuft, in eine neue Heteronomie, also eine Fremdbestimmtheit, umzuschlagen, solange nicht klar ist, wie die Moderne normative Maßstäbe setzen kann, die nicht von außen an sie herangetragen werden.
Die dritte der genannten Positionen tritt gewissermaßen als Kritik an den beiden erstgenannten auf. Sie kritisiert an der ersten Position, der Partei der Aufklärung, eine einseitige Fassung des Emanzipationsverständnisses und verteidigt gegen den Konservativismus der zweiten Position die Emanzipationsgewinne des Aufklärungsprozesses. Es geht in der dritten Position im Wesentlichen darum, ein Autonomieprojekt zu formulieren, das gegenüber den Gefahren einer neuen Fremdbestimmung sensibilisiert. Diese dritte Position ist als Dialektik der Aufklärung bezeichnet worden. Sie ist politisch höchst heterogen, wie sich darin zeigt, dass politisch so unterschiedliche Denker wie Hegel, Marx, Engels und noch Nietzsche hier einzuordnen sind.
Der Marxsche Zugang zum Problem der Moderne scheint mir besonders interessant. Gelegentlich wird Marx ja ein Hang zum Ökonomismus vorgeworfen. Da mag sogar etwas Wahres dabei sein. Freilich muss die Konzentration auf einen wesentlichen Punkt nicht unbedingt ein Fehler sein. Sie ermöglicht es Marx, in seinen Analysen in die Tiefe zu gehen. Das Verhältnis der Emanzipation zur Fremdbestimmung kann ökonomisch konkret wie folgt beschrieben werden: Der Modernisierungsprozess entbindet die Menschen von traditionellen, gemeinschaftlichen Zwängen, erzeugt damit eine moderne Person und setzt eine moderne Kultur frei. Im universellen Tauschverkehr wird dieser Emanzipationsprozess jedoch zur Quelle neuer Fremdbestimmung vor allem für jene, die nur Arbeitskraft anbieten können. Damit wird das Autonomieprojekt der Aufklärung zum höchst eingeschränkten Autonomieprojekt.
Das »Verfahren« von Marx besteht nun darin, aus der kulturellen Moderne Maßstäbe zur Beurteilung der ökonomischen Moderne zu gewinnen. Und darin ist Marx immer noch ein geeigneter Orientierungspunkt für eine Kritik an der Fremdbestimmung der ökonomischen Moderne. Denn die moderne Kultur lässt sich als ein Projekt der Entwicklung freier und selbstbewusster, daher selbstbestimmter Praxisformen verstehen.
Hingegen spielen Märkte zwar eine wichtige Rolle bei der materiellen Reproduktion der Gesamtgesellschaft – und damit auch unserer nichtökonomischen Praxisformen; aber indem die Märkte als Quelle der Fremdbestimmung in Erscheinung treten und dazu tendieren, immer größere Lebensbereiche ihrem Diktat auszusetzen bzw. diesen ihre Logik aufzuprägen, bedrohen sie eben die Entwicklung selbstbestimmter Praxisformen.
Diese eigentümliche Dialektik ist der Ausgangspunkt einer kritischen Beurteilung der ökonomischen Moderne. Wenn man sich auf den Standpunkt von Habermas stellt, dass Märkte sich nicht demokratisieren lassen, wenn sie einen funktionalen Eigensinn haben, der in der Kapitalverwertungslogik nicht aufgeht, kann man zugeben (wie Habermas es auch tut), dass ökonomische Macht kontrolliert werden muss, auch, aber nicht nur, um unerwünschte Nebeneffekte des Marktes abzufedern. Dort aber, und das scheint ja die Signatur unserer Zeit zu sein, wo es Ansätze zu einer Kontrolle ökonomischer Macht gibt, sind sie im Schwinden begriffen.
Vielleicht wird schon jetzt etwas deutlicher, wie ein moderner Sozialismus begriffen werden könnte: Er ist der beständige Versuch, Entfremdungspotenziale der ökonomischen Moderne zu lokalisieren und zu neutralisieren. Er ist damit Bestandteil eines allgemein angelegten Autonomieprojekts. Damit ist andererseits klar, dass jeder Sozialismus, der eine überzogene Modernekritik dergestalt betreibt, dass ihm auch Rechtlichkeit und Demokratie suspekt sind, Autonomie überhaupt gefährdet.
Kapitalismuskritik: Die soziale Frage
Im Folgenden möchte ich die Dringlichkeit einer radikalen Kritik am Kapitalismus begründen. Der Kapitalismus als soziales System ist im Prozess der von Marx so genannten ursprünglichen Akkumulation von Kapital entstanden. Die Produzenten wurden gewaltsam von ihren traditionellen Produktionsbedingungen getrennt. Diejenigen, die über die Produktionsmittel verfügen, die Kapitalbesitzer, unterscheiden sich von denjenigen, die über kein Eigentum verfügen, aus dem ihnen Rechte auf eine Aneignung erwachsen könnten. Kurz – das durch Arbeit im Stoffwechsel mit der Natur Produzierte wurde in privates Eigentum verwandelt. Damit verbunden war eine Inwertsetzung der Natur, die bereits im 15. Jahrhundert in der europäischen Landwirtschaft begann. Die Agrarrevolution erfolgte vor der industriellen Revolution. Sie war die Voraussetzung dafür, dass auf den enteigneten und privatisierten landwirtschaftlichen Flächen die landwirtschaftlichen Erträge beträchtlich gesteigert werden konnten. Die Erhöhung der Produktivität in der Landwirtschaft schuf erst die Voraussetzungen dafür, dass die dort »freigesetzte« Landbevölkerung als Arbeitskräfte in den Manufakturen ihre Arbeitskraft verkaufen und gleichzeitig ihre Ernährung wenigstens halbwegs sichergestellt werden konnte.
Kapitalverwertung war jedoch nur möglich, wenn die eigentumslosen Arbeitskräfte einen Überschuss produzieren, der von den Eigentümern privat angeeignet werden konnte, was eine bestimmte Produktivität voraussetzte. Das Produkt muss also größer sein als das, was zur Reproduktion der Arbeitskräfte und ihrer Familienangehörigen erforderlich ist. Das ließ sich als die – in Anlehnung an die Marxsche Terminologie – absolute Mehrwertproduktion bezeichnen. Sie besteht schlicht darin, dass der Arbeitstag entsprechend verlängert wird.
Die absolute Mehrwertproduktion gibt es selbstverständlich auch heute, trotz aller ungeheuren Produktivitätsfortschritte. Nicht nur in den Ländern der so genannten Dritten Welt, sondern auch bei uns. Die Zahl der in Deutschland geleisteten Überstunden erreicht Rekordwerte, und die Arbeitgeberverbände fordern eine Revision der Arbeitszeitgesetzgebung mit dem Ziel der Verlängerung der Arbeitszeiten.
Eine neue Qualität erreichte der Kapitalismus jedoch erst mit der Produktion des relativen Mehrwerts oder der reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital. Um einen höheren Mehrwert zu erzielen, stand nicht mehr die Verlängerung der Arbeitszeiten im Vordergrund, sondern die Intensivierung der Arbeit selbst, mit Hilfe der Modernisierung und Umwälzung der Produktionsprozesse, die von Marx und Engels im »Kommunistischen Manifest« so gepriesen wurde.
»Die Produktion des relativen Mehrwerts revolutioniert durch und durch die technischen Prozesse der Arbeit und die gesellschaftlichen Gruppierungen«, so Marx im »Kapital«. Erst auf dieser Grundlage entfaltete sich der moderne Kapitalismus, getrieben von den Zielen möglichst hoher Renditen, die das Wachstum und die Produktion bestimmen, und angetrieben von den fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Erdgas, die die anderen Energieformen wie Wind, Wasser, Holz verdrängten. Auf dieser Basis entwickelte der Kapitalismus eine in der Geschichte der Menschheit einzigartige Dynamik.
Wirft man den Blick zurück auf die Entwicklung in den entwickelten kapitalistischen Industrieländern, so erscheint die Epoche nach 1945 als das goldene Zeitalter des Kapitalismus. Ihm ging der Schock der bis dahin größten Weltwirtschaftskrise des Kapitalismus Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts voraus. Die Antworten auf Massenarbeitslosigkeit und Gewinneinbußen war mit dem Namen des britischen Bankiers Keynes verbunden. Der Keynesianismus bestand im Kern darin, durch staatliche Interventionen in die Marktwirtschaft die Massennachfrage zu erhöhen, die benötigt wird, um die Massenproduktion von Gütern auch rentabel zu machen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der keynesianische Interventionsstaat unter den Bedingungen der Systemkonkurrenz mit dem Staatssozialismus zu einer Art modernem Wohlfahrtsstaat erweitert, der sich auf eine breite Akzeptanz der Bevölkerung in den westlichen Industrieländern stützen konnte. Die Wachstums- und Produktivitätsraten waren in den folgenden 25 Jahren außerordentlich hoch, die Renditen gut, und die abhängig Beschäftigten nahmen am Produktivitätsfortschritt durch die Steigerung ihrer Einkommen teil, was wiederum der Kaufkraft zugute kam.
In dieser Zeit konnte eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, eine Verkürzung der Arbeitszeiten, aber auch mehr Teilhabemöglichkeiten der abhängig Beschäftigten wie die Mitbestimmung in Unternehmen von den Gewerkschaften durchgesetzt werden. Erfolgreich war dieses Modell auch deshalb, weil die Arbeitslosigkeit vergleichsweise niedrig lag und die Gewerkschaften weit weniger erpressbar waren als in der Gegenwart.
Der Fortschritt der Akkumulation im Rahmen des fordistischen Akkumulationsregimes ist aber offenbar nicht unbegrenzt möglich gewesen. Ein Grund dafür ist, dass die Kapitalrenditen tendenziell zurückgingen und sich in den siebziger Jahren mehr und mehr zunächst die angebotsorientierte Theorie und dann das Ideologiegebäude des Neoliberalismus einschließlich völkerrechtswidriger Kriege zur Rohstoffsicherung und -eroberung durchsetzen konnte. Zunächst in den USA unter Ronald Reagan, gefolgt von Margret Thatcher in Großbritannien. Andere Länder folgten, und es handelte sich, wie sich herausstellen sollte, nicht nur um ein wirtschaftliches und politisches Projekt der Konservativen und Wirtschaftsliberalen, sondern auch der sozialdemokratischen Parteien eines Tony Blair in Großbritannien und eines Gerhard Schröder in Deutschland. Diese Anpassung der europäischen Sozialdemokratien an den Neoliberalismus und die kritiklose Übernahme ihrer Doktrin hat die Herausbildung und Stärkung der Linken, die dem Neoliberalismus nicht folgten, begünstigt, auch bei uns. Ohne Hartz IV und ohne die völkerrechtswidrigen Kriege unter »Rot-Grün« hätte es wahrscheinlich keineWASG und ebenso wahrscheinlich auch kein Engagement von Oskar Lafontaine für das neue Linke Projekt in Deutschland gegeben.
Mir ist es wichtig, auf zwei wesentliche Veränderungen des real existierenden Kapitalismus hinzuweisen, weil sie für eine Strategie der Linken unbedingt Berücksichtigung finden müssen. Es ist die Globalisierung und die Weiterentwicklung dieses Kapitalismus zu einem finanzgetriebenen Kapitalismus, einem »Raubtierkapitalismus«, wie der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt ihn nannte, oder auch zu einer »Diktatur des Finanzkapitals über das Industriekapital «.
Die Herausbildung eines umfassenden Weltmarktes ergibt sich aus der Logik des kapitalistischen Verwertungsprozesses, die Dimensionen von Raum und Zeit optimal zu verdichten. Der Begriff der Globalisierung hat sich erst nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus durchgesetzt. Die Globalisierung spielt sich in zwei Dimensionen ab. Erstens in dem Bestreben, alle bestehenden territorialen Grenzen einzureißen. Und zweitens in einer immensen Beschleunigung aller ökonomischen Prozesse, angefangen bei der Produktion, dann der Konsumtion, der Kommunikation dank des relativ neuen Mediums des Internet, des Transports und überhaupt des Verkehrs. Das Sprichwort »Zeit ist Geld« könnte man als Leitgedanken für diese Entwicklung bezeichnen.
Für die Globalisierung tragen die politischen Entscheidungsträger in den Industrieländern eine große Mitverantwortung. Sie unterwarfen sich den Interessen der Global Players. Den knallharten ökonomischen Gesetzen des Marktes folgend, wurden Zölle abgebaut, globale Standards bei Industrienormen, globale Standards bei der Bewertung von privaten und staatlichen Schuldnern festgelegt, die die nationalstaatlich gesetzten Rahmenbedingungen sprengten.
Die Marktkräfte wurden so schrittweise aus ihrer Gefangenschaft der natürlichen Umweltbedingungen und der sozialen Beziehungen in den Gesellschaften freigesetzt und somit schrittweise auch aus den politischen Bindungen und Verpflichtungen. Die Stichworte hierzu lauten Deregulierung, Liberalisierung und Privatisierung. Damit wurde der keynesianische Interventionsstaat entweder zerstört oder ziemlich durchlöchert. Das war nicht der Markt, sondern, wie gesagt, das waren politische Akteure, die den gnadenlosen Gesetzen des Marktes folgten und den Bürgerinnen und Bürgern mehr Wohlstand und Wachstum versprachen, in Wirklichkeit jedoch eine gigantische Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von unten nach oben in Gang setzten, die sich letztlich gesellschaftszerstörerisch auswirkt.
Ich will die wichtigsten politischen Maßnahmen kurz benennen, die auch die Bundesregierungen, angefangen bei Kohl, deutlicher Schröder und Merkel, trafen.
Hinsichtlich der Deregulierung wurden Vorschriften für den internationalen Warenaustausch, für ausländische Direktinvestitionen und den Kapitalverkehr abgebaut. Es war die rot-grüne Bundesregierung, die die Hedge-Fonds zuließ und die Steuern bei Verkäufen durch Kapitalgesellschaften gleich ganz abschaffte.
Bei der Liberalisierung wurden Kapitalverkehrskontrollen beseitigt und Handelshemmnisse abgebaut. Und öffentliche Güter und staatliche Unternehmen, angefangen bei der Post, der Telekom und den Energiekonzernen – nun soll auch die Bahn folgen – wurden ebenso Opfer der Privatisierung wie kommunale Wohnungsbauunternehmen und zunehmend auch Krankenhäuser. All diese Bereiche wurden aus ihrer Verpflichtung zum Gemeinwohl der Logik des Profits unterstellt.
Damit hat sich der Staat freiwillig seiner eigenen wirtschaftlichen Machtinstrumente entledigt und dem Markt überlassen. Das ist beileibe nicht nur eine ökonomische Frage. Nahezu jede Privatisierung bedeutet auch die Preisgabe politischen Einflusses und gesellschaftlicher Gestaltung. Wenn jedoch ein Bürgermeister in einer Stadt Krankenhäuser,Wohneigentum, die Abfallwirtschaft, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung privatisiert hat, hat er auch nichts mehr zu entscheiden. Dann fragen sich die Bürgerinnen und Bürger zu Recht, weshalb sie überhaupt noch wählen gehen sollen, wenn ihr Gemeinderat und der Bürgermeister bei Beschwerden und Forderungen nur noch mit den Achseln zucken können? Dieser Abbau des Primats der Politik über die Wirtschaft baut aber zugleich die Bedeutung der Demokratie ab, ist also undemokratisch.
In manchen Ländern gab es Versuche, den Keynesianismus wieder zurückzuholen, aber das erwies sich als nahezu unmöglich. Als Oskar Lafontaine als damaliger Finanzminister der Währungsspekulation Einhalt gebieten wollte und kalkulierbarere Zielzonen der wichtigsten Währungen vorschlug, wurde er gnadenlos von den internationalen Finanzmärkten abgestraft. Das Urteil dafür übermittelte ihm der damalige Bundeskanzler.
Diese Episode verweist darauf, dass die nationalstaatliche Souveränität in Teilen der Wirtschafts-, Währungs- und Finanzpolitik abgebaut und an supranationale Institutionen übertragen wurde. Ich nenne nur das Beispiel des Euro, der gemeinsamen europäischen Währung, oder die Übertragung der Zuständigkeiten der Deutschen Bundesbank auf die Europäische Zentralbank. Seitdem ist eine bundesdeutsche, nationale Zins- und Wechselkurspolitik nicht mehr möglich.
Eine Rückkehr zum Interventions- und Wohlfahrtsstaat der goldenen Ära nach 1945 ist auch dadurch erschwert, dass der sozialstaatliche Kompromiss längst aufgekündigt wurde. Die Gewerkschaften wurden entscheidend geschwächt, auch die SPD betrachtet es nicht mehr als zeitgemäß, Rücksichten auf die Gewerkschaften zu nehmen. Unter Schröder wurden sie geradezu gedemütigt. Forderungen nach Verkürzung der Arbeitszeit werden abgebügelt, ein gesetzlicher Mindestlohn hat hier kaum Realisierungschancen.
Schließlich sollte eine der gravierendsten Veränderungen des Kapitalismus in den letzten Jahren nicht unterschätzt werden: Infolge der Deregulierung der Kapital- und Finanzmärkte und der Jagd nach immer höheren und schnelleren Renditen, dem so genannten »Shareholder Value«, haben die globalen Finanzmärkte einen bedeutenden Einfluss auch auf die reale Wirtschaft, das heißt zum Beispiel auf die Produktion von Waren, genommen.
Ihre Wachstumsraten mit Finanzprodukten aus der Währungs-, Wechselkurs- und Aktienspekulation übertreffen die Wachstumsraten des Handels mit Gütern und Dienstleistungen bei weitem.
An einem einzigen Tag werden weltweit rund 1 900 Milliarden Dollar auf den Finanzmärkten umgesetzt. Im Vergleich dazu betragen die weltweiten Warenexporte 36 Milliarden Dollar pro Tag. Das ist ein Anteil von 2 Prozent gegenüber den 98 Prozent, die auf den Finanzmärkten umgesetzt werden.
Auf den Finanzmärkten gelten andere Gesetze und Größenordnungen als in der realen Ökonomie. Maßstab sind Renditen von mindestens 20 Prozent, die in der Realwirtschaft nur in Ausnahmefällen zu erzielen sind.
Die noch von Marx beschriebene Bildung einer durchschnittlichen Profitrate auf nationalen Märkten ist heute kein Maßstab mehr. Profitraten orientieren sich nach international zu erzielenden Renditen, die kurzfristig zu erzielen sind. Aber die Logiken auf diesen Märkten setzen die realwirtschaftliche Ökonomie gehörig unter Druck.
Renditen von über 20 Prozent überfordern die reale Ökonomie bei weitem und sind nur kurzfristig erreichbar. Beim Wettbewerb auf den internationalen Finanzmärkten geht ein Druck auf die Erhöhung der Zinsen aus, während das Kapital bei realen wirtschaftlichen Investitionen »billig« sein muss, das heißt, dort sind niedrige Zinsen attraktiver.
Die Finanzmärkte agieren teilweise zerstörerisch und entziehen ihren hohen Renditen letzten Endes die Basis. Auf der Jagd nach immer höheren Renditen werden die Hedge-Fonds, bei uns auch »Heuschrecken « genannt, aber auch die Pensionsfonds vor allem aus den USA und Großbritannien immer aggressiver.
Damit entsteht aber auch ein größerer Druck auf die Gewinnerwartungen bei den Kapitalanlegern im ökonomischen Sektor des produktiven Realkapitals. Das Resultat ist ein erhöhter Rationalisierungsdruck, dem durch verschiedene Maßnahmen wie Outsourcing, Flexibilisierung, Abflachung von Unternehmenshierarchien, Etablierung von Netzwerkstrukturen, Stilllegung unproduktiver Bereiche, Lohnsenkung und Freisetzung von Arbeitskraft entsprochen wird.
Dementsprechend dominieren bei den Investitionen die Rationalisierungsinvestitionen gegenüber den Erweiterungsinvestitionen. Die hochtechnologischen Innovationen, insbesondere in der Informationstechnologie, sind ein Produktivkraftschub, der die Rationalisierungsinvestitionen enorm begünstigt hat.
Die Dominanz der Finanzmärkte übt Druck auf das Realkapital aus, das sich zu rasanten Rationalisierungen genötigt sieht. Insbesondere die Freisetzung von Arbeitskraft und die diversen Lohnsenkungsstrategien schwächen aber die Binnennachfrage, die zu einer verstärkten Weltmarktorientierung und einem weiteren Abwandern des Kapitals aus der produktiven Sphäre in die Finanzmärkte führt. Das dämpft weiter das Wirtschaftswachstum.
Der Staat gerät hier in die Zwickmühle. Die starke Zunahme an Ausgaben für Sozialleistungen wie auch eventuelle Konjunkturprogramme belasten den Staatshaushalt. Der Staat steht vor der Alternative, zwischen Steuererhöhung und Neuverschuldung wählen zu können. Es wird eine Umverteilung von unten nach oben organisiert. Denn die Gewinner dieses Prozesses, die Profitmaximierer an den Finanzmärkten, werden nicht zur Kasse gebeten, dafür aber diejenigen, derer man leichter habhaft werden kann. Das sind Bezieher mittlerer und kleiner Einkommen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
Auch die Staatsverschuldung bewirkt unter diesen Umständen Umverteilung von unten nach oben. Im Falle des Kredits spekuliert der Gläubiger ja auf einen Profit des Schuldners, an dem er sich Anteile sichert. Der Gläubiger, der den Staat zum Schuldner hat, erwirbt einen Anteil an den Steuereinnahmen des Staates. Wenn nun der Staat sich aufgrund einer durch Kapitalspekulation auf den Finanzmärkten hervorgerufenen Verlangsamung des Wirtschaftswachstums verschuldet, so werden Gewinne der Finanzmärkte zur Quelle neuer Gewinne, nämlich der Zinseinnahmen. Wenn der Staat dem entgegensteuern will, dann scheint ihm nur eines übrig zu bleiben: die Entlastung des Kapitals von Steuern und Abgaben. Das ist die Standortlogik.
Damit verbundene Einnahmeverluste des Staates müssen freilich kompensiert werden: zum Beispiel durch die massive Kürzung von Sozialleistungen. Unter Rot-Grün haben die Arbeitsmarktreformen, die mit dem Namen Hartz verbunden sind und nun einen weiteren unangenehmen Beigeschmack bekommen haben, und die Kürzungen bei den Renten und der Gesundheit begonnen und werden unter Schwarz-Rot fortgeführt. Ich nenne hier nur die Gesundheitsreform, die Rente ab 67 und die Kürzung der Pendlerpauschale.
Der Neoliberalismus erweist sich also als höchst asozial. Er untergräbt Mindeststandards der sozialen Gerechtigkeit. Damit jedoch ist er es, der die soziale Frage nicht nur bei uns, sondern weltweit neu stellt. Und sie wird zumindest in Teilen der Welt nicht gerade zur Zufriedenheit der Neoliberalen beantwortet. Vor allem nicht in Lateinamerika, aber auch bei uns nicht uneingeschränkt.
Die Ablehnung des Entwurfs einer europäischen Verfassung bei den Volksabstimmungen in Frankreich und den Niederlanden resultiert auch daraus, dass eine neoliberal orientierte EU, die versucht, im Teil III dieser Verfassung einem falschen Wettbewerb verfassungsrechtliche Weihen zu geben – danach muss man in unserem Grundgesetz vergeblich suchen –, mehr Befürchtungen und Unsicherheiten bei den Bürgerinnen und Bürgern auslöste als Zustimmung.
Wenn wir Gerechtigkeit auch als Verteilungsgerechtigkeit begreifen, ist der heutige Kapitalismus – soviel sollten die bisherigen Ausführungen erkennen lassen – eine katastrophale Ungerechtigkeit. Aber zur Gerechtigkeit gehört mehr. Alle Menschen haben ein Recht auf Gleichheit. Damit ist keine Gleichmacherei gemeint. Ich meine aber, dass es grundsätzliche Relationen der Gleichheit geben muss.
Am selbstverständlichsten scheint uns das im Recht. Vor dem Gesetz ist jeder gleich. In der Moral anerkennen wir uns wechselseitig an als Wesen, die für ihr Handeln vernünftige Begründungen abgeben können, und im Politischen sind wir Bürgerinnen und Bürger der res publica. Ohne derartige Basisrelationen der Gleichheit ist gesellschaftliche Selbstbestimmung und damit Freiheit – und das ist eine wesentliche Dimension der Gerechtigkeit – nicht möglich. Unsere Gesellschaft läuft aber Gefahr, nicht einfach nur faktisch Gesellschaftsmitglieder abzuhängen, das tut sie längst, sondern auch den Anspruch auf soziale Inklusion aller aufzugeben. Damit zerstört sie das Autonomieprojekt als Ganzes.
Es gibt nun einen Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit als Verteilungsgerechtigkeit und Gerechtigkeit als Gleichheit. Wenn die gesellschaftliche Umverteilung von Einkommen und Arbeit in der gerade aktuellen Weise voranschreitet, dann werden diese Gleichheitsrelationen untergraben. Die Rechtsgleichheit wird dadurch untergraben, dass sich die Besitzenden bessere Möglichkeiten zur Durchsetzung von Ansprüchen leisten können und dass dabei Zeiten vergehen, die sich Ärmere nicht leisten können. Die Gleichheit aller als moralische Personen wird durch Diskurse zu der so genannten Eigenverantwortung untergraben: Verliererinnen und Verlierer des ökonomischen Systems erscheinen als nicht wahrnehmungsfähig hinsichtlich ihrer Verantwortung für sich selbst; die Gleichheit aller als Bürgerinnen und Bürger wird untergraben, indem erstens der Staat immer weniger handlungsfähig wird, zweitens die faktische Ausgrenzung eines Teils der Bürger aus der Gesellschaft die Entfremdung zum Gemeinwesen vergrößert, und drittens die politische Klasse zynisch gegenüber ihrer in Gestalt von Wahlprogrammen verkündeten Ideologie wird und sich so von der Gesellschaft als Ganzes zunehmend entfremdet.
Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass es parlamentarische Mehrheiten für die Rente ab 67, für die Pendlerpauschale, für die Mehrwertsteuererhöhung, um nur drei Beispiele zu nennen, gab. Den 65 Prozent Zustimmung im Bundestag standen jedoch, wenn man den Meinungsumfragen Glauben schenken darf, 65 Prozent Ablehnungen dieser Maßnahmen – Reformen kann man diese sozialen Leistungskürzungen wohl kaum nennen – in der Bevölkerung gegenüber. Auch das führt zur wachsenden Parteien- und somit auch Politikverdrossenheit, die sich übrigens auch negativ auf die Oppositionsparteien auswirkt, weil sie einfach dem Parteiensystem zugeschlagen werden. Und Politikverdrossenheit kann wiederum in Demokratieverdrossenheit umschlagen.
Die gesellschaftliche Akzeptanz des Shareholder-Kapitalismus ist gering. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land messen der sozialen Gerechtigkeit eine wachsende Bedeutung zu, zumal die Unsicherheiten um einen Arbeitsplatz, um Existenz sichernde Einkommen, um sichere Renten im Alter, die Ängste vor einem sozialen Absturz in Hartz IV auch die Gefahren in sich bergen, dass autoritäre Lösungen an Attraktivität gewinnen könnten.
Schon aus diesem Grund ist eine Kritik von links am real existierenden und spekulierenden Kapitalismus nicht nur eine abstrakte Einsicht. Sie ist notwendig, um die Ängste vieler Menschen und die Ursachen hierfür ernst zu nehmen. Sie ist erst recht notwendig, weil die herrschenden neoliberalen Parteien von ihrer Politik immer behaupten, zu ihr gäbe es keine Alternative. Doch es gibt Alternativen von links. Dazu später mehr.
Kapitalismuskritik: Umweltzerstörung und neue Kriege
Es ist nicht nur die soziale Frage, die die Frage nach gesellschaftlichen Alternativen, die über den Kapitalismus hinausweisen, zwingend stellt. Ich behaupte, dass der Kapitalismus auch nicht in der Lage ist, die ökologische Frage zu lösen. Im Gegenteil, er trägt zur Verschärfung der ökologischen Krise bei, und ich fürchte, dass der völkerrechtswidrige Krieg gegen den Irak, der auch ein Krieg ums Öl ist, nur ein Vorspiel auf kommende globale Auseinandersetzungen im Kampf um die knapper werdenden natürlichen Ressourcen, vor allem um die fossilen Energieträger, ist.
Die Industrialisierung, die vor etwa 200 Jahren begann, basierte ganz wesentlich auf den neuen Energieträgern Öl, Gas und Kohle. Die industrielle Revolution war somit auch eine fossile Revolution. Um die externen Folgekosten machte man sich die meiste Zeit über keine großen Gedanken: weder über die Folgen für das Klima durch den vermehrten Ausstoß von Kohlendioxid, noch über die Endlichkeit dieser Ressourcen.
Selbst die vorhandenen Angaben über die realen Vorkommen sind mit Vorsicht zu genießen. Sie sind häufig übertrieben, um das ökonomische Interesse an alternativen Energieressourcen zu bremsen. In einigen Ländern ist der Punkt, an dem die Nachfrage nach Öl dessen Fördermenge übersteigt, bereits überschritten; in den USA etwa seit den 70er Jahren. Weltweit soll der Punkt unterschiedlichen Schätzungen zufolge entweder schon überschritten sein oder in mehreren Jahrzehnten erreicht werden.
Das Problem wird dadurch verschärft, dass der Energiehunger wachstumsstarker Länder wie China und Indien den Kampf um die Erdölressourcen verschärft. Dieser Kampf könnte auf friedliche, marktwirtschaftliche Weise ausgetragen werden, indem die Knappheit der Ressource über den Preis angezeigt wird. Das geschieht auch.
Aber damit geben sich die Ton angebenden Industriestaaten, vor allem die USA und die NATO-Staaten, nicht zufrieden. Es ist beileibe kein Zufall, dass die NATO-Doktrin gleich nach dem Scheitern des Staatssozialismus auf die »Sicherung der Ölquellen« erweitert wurde.
Lässt sich eine Ressource nicht auf dem herkömmlichen, marktwirtschaftlichen Weg aneignen, dann erfolgt gegebenenfalls die gewaltsame Aneignung. Wie gesagt, der Irakkrieg war und ist auch ein Krieg ums Öl. Auch der ebenso völkerrechtswidrige Krieg gegen Afghanistan hatte den willkommenen Nebeneffekt, dass die USA ihre Militärbasen nördlich von Afghanistan, im kaukasischen Gürtel der Nachfolgestaaten der Sowjetunion, anlegen konnten. Auch diese Länder verfügen über größere Erdöl- und Erdgasvorkommen.
Das Erdöl ist aber nicht nur eine Energieressource, sondern auch ein unentbehrlicher Rohstoff. Das sollen die folgenden Beispiele andeuten:
Erstens: Die Herstellung eines Autos erfordert etwa 20 Barrel oder umgerechnet 3000 Liter Öl. Das entspricht etwa 10 Prozent der Energie, die es während seiner Lebensdauer verbraucht.
Zweitens: Die Herstellung von einem 32-Mega-Bite-Chip benötigt 1,6 kg Öl und 32 Liter Wasser.
Drittens: Die Herstellung eines Rechners erfordert das Zehnfache seines Gewichts an Öl. Aufgrund der hohen Reinheit und Sauberkeit, die zur Herstellung eines Mikrochips notwendig sind, benötigt man für die Herstellung von neun bis zehn Rechnern die gleiche Menge an Öl wie für ein Auto.
Marx nannte die Produktion einmal den »Stoffwechsel mit der Natur«. Bei der Beurteilung einer Produktionsweise ist einmal das »innere«, durch gesellschaftliche Verhältnisse vermittelte, Moment der Produktionsweise zu betrachten, ganz sicher aber auch das äußere, eben jener Stoffwechsel.
Er markiert ein absehbares Ende einer Produktionsweise, der hingegen ein »Weiter so« eingeschrieben scheint. Ein anderer Aspekt, der anzeigt, dass der Stoffwechsel gestört ist, sind die Belastungen der natürlichen Umwelt. Und auch kann ein Ende kommen, ein natürliches Ende zumindest für die Menschheit, und sei es in Gestalt einer kollabierenden Umwelt.
Es existiert also ein Widerspruch zwischen dem »Akkumulationstrieb« des Kapitalismus auf der einen Seite und dem Ende des Wachstums auf der anderen Seite. Es muss sich daher in unserer Produktionsweise etwas ändern.
Eine Antwort des kapitalistischen Systems ist ein »Augen zu und durch!« und ein Hinausschieben einer Politik des »Weg vom Öl« mit all seinen Konsequenzen. Denn ein Ersatz des »schwarzen Goldes« durch regenerative Energien hätte tief greifende Auswirkungen auf Produktion, Konsumtion, auch unsere Lebensweise und Kultur.
So lange die politischen Eliten einer Wachstumsideologie ihr Ohr leihen, bleiben sie auch anfällig für diese strategische Antwort. Und das ist der Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Krieg. Anders ausgedrückt: Wenn sich unsere Ökonomien von fossilen Energieträgern emanzipierten, wäre das ein nicht zu unterschätzender Beitrag auch für eine dann mögliche Friedenspolitik.
Ich bezweifle jedoch, dass die Herrschenden dazu überhaupt willens und fähig sind. Die einzige Antwort der herrschenden Politik und auch vieler, nicht aller, Ökologie- und Umweltverbände lautet: »Effizienzrevolution«. Also den sparsameren, nachhaltigeren Umgang mit den fossilen Energieträgern und ein Umstieg auf erneuerbare Energien. Nur: Die Steigerung der Effizienz müsste global erfolgen. Wenn das eine Land sparsamer mit den knappen Ressourcen umgeht, heißt das noch lange nicht, dass alle anderen Länder diesem Beispiel folgen.
Da die Grünen den Kapitalismus nicht überwinden wollen, sind sie im Kern keine ökologische Partei.
Für die Linke und für linke Alternativen bedeutet dies, nicht nur Antworten auf die soziale Frage zu suchen und zu finden, sondern die soziale Frage mit der ökologischen Frage zu verbinden. Erst dann wird ein Schuh draus, nämlich eine gesellschaftliche Alternative nach mehr sozialer Gerechtigkeit und größtmöglicher demokratischer Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an dem »Was« und dem »Wie« der künftigen Produktion und Konsumtion, und es entsteht die Vision eines »postfossilen« Zeitalters, das einen Bruch mit dem 200 Jahre alten industriellen Wachstumsmodell bedeutete.
Gibt es Alternativen?
Aus den bitteren Erfahrungen des gescheiterten Staatssozialismus in der Sowjetunion und den osteuropäischen Staaten, einschließlich der DDR, lautete eine wichtige Erkenntnis der aus der SED hervor gegangenen PDS, der heutigen Linkspartei, dass eine soziale Umwälzung, eine Revolution nicht von einer zumeist selbst ernannten Avantgarde zu Stande kommt, die sich obendrein auch noch wähnt, im alleinigen Besitz der Wahrheit zu sein.
Eine Überwindung dieser kapitalistischen Verhältnisse kann und muss in einer Demokratie enden und auf demokratischem Weg erfolgen, mit dem Risiko, auf demokratischem Weg auch wieder abgewählt zu werden. Dann waren die Vorschläge der Sozialistinnen und Sozialisten eben nicht gut genug. Die Überwindung setzt zweitens einen über viele Jahre währenden Prozess der Aneignung von Wissen und Erfahrungen aus den gesellschaftlichen Auseinandersetzungen voraus. Genau an diesen Prozessen beteiligen sich die Linkspartei. PDS und die WASG, die sich im Sommer zu einer gemeinsamen linken Partei vereinigen wollen, und zwar zusammen mit sozialen Bewegungen, den Gewerkschaften und anderen Initiativen, um von ihnen zu lernen und um ihre Forderungen aufzugreifen und im Bundestag oder den Landesparlamenten zur Sprache zu bringen.
Bei Friedrich Engels fand ich in »Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft« in Bezug auf Revolutionen einen interessanten Hinweis aus der bürgerlichen Revolution. Engels wies auf die Tatsache hin, dass die Umwälzung in Frankreich Ende des 18. Jahrhundert durch einen politischen Umsturz erfolgte, während in England der große Knall ausblieb, sich aber die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse ebenso revolutionär über die Entwicklung der modernen Industrie und die Veränderung der Produktions- und somit auch der Gesellschaftsstrukturen durchsetzten. Trotz der Königinnen und Könige.
In beiden Fällen verliefen die revolutionären Prozesse erfolgreich, weil die Verhältnisse dazu herangereift waren.
Heute über die Alternativen jenseits des real existierenden Kapitalismus mit seinen entbändigten Märkten zu reden, mutet als völlig abwegig an, weil es uns nicht einmal gelingt, den Sozialstaatskompromiss, der noch unter Helmut Kohl weitgehend galt, gegen das Vordringen des Neoliberalismus zu verteidigen.
Mit der einzigen Ausnahme der Linksfraktion haben die übrigen Parteien die neoliberalen Postulate von mehr Deregulierung, Privatisierung und Liberalisierung adaptiert, die Union und die FDP am radikalsten, die Grünen in dem Bemühen, zum herrschenden Zeitgeist aufzuschließen, die SPD zumindest mit einer mittleren Variante. Das trübt die Aussichten auf Alternativen und auf einen Bruch mit diesem herrschenden Zeitgeist.
Aber es gibt auch hoffnungsvolle Zeichen. Die Proteste gegen Hartz IV und gegen die völkerrechtswidrigen Kriege sind Belege dafür, dass es einen nennenswerten Widerstand gegen die herrschende Politik gibt. Einen Neoliberalismus in Reinkultur, wie er unter einer schwarz-gelben Regierung konzipiert war, scheiterte an den Wählerinnen und Wählern, denen ein Steuerkonzept eines Professors aus Heidelberg mehr Ängste einjagte. Die 8,7 Prozent oder über vier Millionen Wählerinnen und Wähler, die für die Linke votierten, haben eine große Koalition erzwungen und somit das kleinere Übel gegenüber »Schwarz-Gelb«.
Dennoch, der Weg für Veränderungen ist ungleich schwerer als noch in den Zeiten des so genannten sozialdemokratischen Zeitalters der Nachkriegsära. Das hängt sowohl mit der Globalisierung als auch mit der Vorherrschaft des Neoliberalismus zusammen.
Ich will dafür ein Beispiel nennen. Die Energieversorgung wurde privatisiert. Wäre sie im staatlichen Eigentum verblieben, hätte der Staat mehr Einnahmen, die nun privat angeeignet werden. Noch wichtiger wäre, dass wir im Bundestag Druck machen könnten auf eine stärkere Förderung von erneuerbaren Energien. Dazu hätte man auch staatliche Investitionen bereitstellen können. Man hätte auch Einfluss auf die Preisgestaltung nehmen können, beispielsweise in der Weise, dass Rentner mit einer minimalen Grundrente oder Hartz- IV-Bezieher Sondertarife erhalten.
Stattdessen muss erst die Auseinandersetzung um die Gestaltungsmöglichkeit geführt werden. Also eine Auseinandersetzung, dass die Energieversorgung wieder vergesellschaftet wird, was sie ja über Jahrzehnte war.
Ein großer Teil dessen, was dereguliert, privatisiert oder liberalisiert wurde, müsste wieder zurückgenommen werden, um sich wieder ein Stück weit Gestaltungsmacht der Gesellschaft zu erobern. So haben wir beispielsweise beantragt, das frühere Verbot von spekulativen Hedge-Fonds wieder wirksam werden zu lassen, die erst unter der rot-grünen Bundesregierung zugelassen wurden. Wir beantragten übrigens eine namentliche Abstimmung über unseren Antrag. Franz Müntefering stimmte gegen unseren Antrag. So viel Schrecken dürften ihm die Heuschrecken dann ja wohl doch nicht eingeflößt haben.
Öffentliche Güter wie die Energie, die Wasserversorgung und -entsorgung, der öffentliche Nah- und Fernverkehr, ein Teil der Wohnungen, die medizinische Versorgung, ein beträchtlicher Teil der Kultureinrichtungen, Schulen, Hochschulen und Bildung sind entweder vor einer Privatisierung zu bewahren oder wieder zu vergesellschaften. Es handelt sich, wenn Sie so wollen, um eine Wiederaneignung öffentlicher Güter oder Güter der öffentlichen Daseinsvorsorge, die für alle Bürgerinnen und Bürger chancengleich zugänglich sein und bereitgestellt werden müssen.
Privatisierung findet nicht nur bei vormals öffentlichen Unternehmen und Einrichtungen statt. Zunehmend werden auch die Risiken des Lebens bei der Gesundheit, beim Alter, bei der Pflege privatisiert. Bei der Gesundheit durch Zuzahlungen, die Praxisgebühr und die Zusatzversicherung bei Zahnersatz und Krankenhausaufenthalt. Bei den Renten über die Riester-Rente und dadurch, dass landauf, landab gesagt wird, die Renten seien nicht mehr so sicher, also versichert euch zusätzlich privat usw.
Aus der Sicht der Neoliberalen ist die Unsicherheit bei den Menschen eine hervorragend funktionierende Politik. Sie führt nämlich zur Entsolidarisierung oder lässt Solidarität gar nicht erst aufkommen. Dieser weiteren Privatisierung der Lebensrisiken können Linke nicht zustimmen, sondern müssen für den Erhalt und den Ausbau solidarischer Sozialversicherungssysteme kämpfen.
Ebenso müssen wir im Bereich der erfolgten Deregulierungen der Finanzmärkte wieder re-regulieren, die rein spekulativen Hedge- Fonds wieder verbieten, das Ausschlachten von Unternehmen durch Private-Equity-Fonds durch steuerliche Sanktionen verhindern, Veräußerungsgewinne der Kapitalgesellschaften wieder besteuern.
All diese Forderungen haben mit einer Transformation dieser Gesellschaft erst einmal nichts zu tun. Damit erreichen wir bestenfalls ein Niveau an Regulierung und die Wiedereinbettung der Marktwirtschaft in die Gesellschaft wie in den siebziger oder achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts. Es handelt sich eigentlich um sozialdemokratische, nicht um sozialistische Politik, die die Linke einfordern muss, weil sich die SPD entsozialdemokratisiert hat. Aber diese Schritte sind notwendig, um überhaupt wieder politische und gesellschaftliche Gestaltungsmacht gegenüber den Kräften des Marktes zurück zu gewinnen. Denn erst unter den dann gegebenen Bedingungen lassen sich weitere Formen der Vergesellschaftung, der aktiven Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den wirtschaftlichen Prozessen und ihrer Entwicklungsrichtung vorantreiben, die über das rein sozialdemokratische Projekt hinausweisen.
Nur so erreicht man wieder ein Primat der Politik über die Wirtschaft und damit eine wesentlich stärkere Relevanz von Demokratie.
Genau diese Politik und diese Forderungen sind der Kritik der Neoliberalen, der Parteien, die sich dem Neoliberalismus verschrieben haben, und des Mainstreams der Medien ausgesetzt. Sie werfen uns eine im Grunde genommen konservative Politik vor, weil wir zurück in keynesianische Zeiten wollten. Ja, das wollen wir auch, weil sie für die gesellschaftliche Teilhabe der Menschen, für die bewusste Gestaltung gesellschaftlicher Entwicklungen eine Voraussetzung ist. Nicht konservativ, aber asozial sind die Neoliberalen, die ihre Politik als besonders modern anpreisen, in Wirklichkeit nur die Apologeten eines ungezügelten Marktes sind und dabei schon fast religiöse Züge annehmen. Ich jedenfalls erkenne keinen Fortschritt daran, wenn unter der Dominanz des Marktes und seiner Gesetze der soziale Zusammenhalt der Gesellschaft zerstört wird.
Ein weiteres Problem, das sich für die Linke stellt, ist die partielle Aufgabe oder Übertragung vormals nationaler Souveränitätsrechte an supranationale Institutionen wie die Welthandelsorganisation WTO oder, näher liegend, die Institutionen der EU. Ich hatte bereits anfangs darauf hingewiesen, dass Deutschland keine nationale Währungs- und Zinspolitik mehr betreiben kann. Das gilt darüber hinaus auch für klassische Konjunkturprogramme zur Belebung des Binnenmarktes und Stärkung der Kaufkraft im Falle von konjunkturellen Krisen. Eine bewusste Inkaufnahme einer staatlichen Neuverschuldung zur Belebung der Wirtschaft, etwa durch das Auflegen eines Investitionsprogramms, ist nur in einem sehr begrenzten Rahmen möglich.
Ich will das an dieser Stelle nicht vertiefen, aber die Notwendigkeit unterstreichen, dass viele politische Veränderungen nur im Rahmen der EU erreicht werden können.
Die Auseinandersetzungen um die EU-Dienstleistungsrichtlinie, die es Dienstleisterinnen und Dienstleistern erlauben sollte, innerhalb der EU zu den Bedingungen ihrer Herkunftsländer zu arbeiten, konnte weitgehend dank der Proteste der Gewerkschaften verhindert werden. Das ist ein Hinweis für die Notwendigkeit, in der EU zu gemeinsamen möglichst hohen sozialen Mindeststandards und ökologischen Standards zu kommen, die nicht unterlaufen werden dürfen.
Das gilt auch für die Harmonisierung der Unternehmenssteuern, um Kapitalflucht zu verhindern. Hier müssen wir also den nationalstaatlichen Handlungsrahmen mit einer Strategie der Zusammenarbeit mit anderen linken Kräften in der EU, außerparlamentarisch wie parlamentarisch, erweitern, weil wir allein auf nationalstaatlicher Ebene scheitern würden. Daher messe ich dem Kampf für eine neue Verfassung, für ein sozial gestaltetes Europa, das sich im Übrigen auch von einer Militarisierung der Außenpolitik verabschieden sollte, eine zentrale Bedeutung zu.
Lassen Sie mich, da es hier ja um die gesellschaftlichen Perspektiven jenseits des Kapitalismus geht, auf ein Reizthema der Linken kommen: Wie halten wir es mit den Märkten? Ich glaube nicht, dass sich Märkte abschaffen lassen. Und wir sollten es auch nicht tun, da Märkte sich als äußerst effizient erwiesen haben.
Überall da, wo Geld als Steuerungsmedium ausfällt, bedarf es anderer Steuerungsmedien oder direkter Koordination. Eine marktfreie Gesellschaft stünde dann vor der Alternative, die Bedeutung des Staates in der Ökonomie massiv aufzuwerten oder alle möglichen ökonomischen Prozesse im Rahmen der freien Kooperation stattfinden zu lassen. Da freie Kooperationen ausschließlich durch die Moral der Kooperierenden stabilisierbar sind, besteht hier die Gefahr der moralischen Entlastung durch staatlich-bürokratische Handlungskoordination. Man muss ja nicht den Teufel an die Wand malen, um zu sehen, dass hier Gefahren lauern, die man bestimmt nicht mit einer Idee der Marktaufhebung beabsichtigt: nämlich die Kolonisierung der Lebenswelt statt durch Marktimperative nun durch bürokratische Imperative.
Eine solche Wirtschaft endet wie im Staatssozialismus als unproduktive Mangelwirtschaft. Sie begünstigt auch einen großen Mangel an Freiheiten und Demokratie, weil Mechanismen zum Interessenausgleich entbehrlich erscheinen.
Eine andere Frage ist, wie viel Markt wir brauchen, wie viel staatlich gesteuerte Ökonomie, wie viel wir auch freier Kooperation zutrauen. Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass der gegenwärtige Zustand des Kapitalismus, der sich dadurch auszeichnet, dass Märkte sowohl institutionell als auch territorial völlig entgrenzt sind, überwunden werden muss. Ein Zustand muss hergestellt werden können, in dem die Gesellschaften selbstbestimmt ihre Ökonomie wieder steuern könnten. Dann wäre es auch möglich, sowohl soziale Ziele wie Gerechtigkeit als auch ökologische Ziele ins ökonomische System einzuspeisen. Notwendig dafür ist eine Rahmenplanung zur Verwirklichung wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Ziele.
Eine Gesellschaft benötigt meiner Auffassung nach alle notwendigen Machtmittel, um ökonomische Prozesse so steuern zu können, dass Kapitaleffektivität und Produktivität, also dasjenige, was als richtig angesehen wird, konvergieren. Das wird aber nur gehen, wenn Preise gesellschaftlich kontrolliert werden können. Ebenso könnte über eine Rahmensteuerung die gesellschaftliche Verteilung von Gütern nach Gerechtigkeitsgesichtspunkten geregelt werden. Schließlich ist die gerechte Verteilung der Arbeit Gegenstand einer gesellschaftlichen Rahmenplanung.
Anders ausgedrückt: Außerhalb der Schlüsselbereiche und öffentlichen Daseinsvorsorge ist eine faire, chancengleiche Marktwirtschaft wichtig, weil sie zu große private wirtschaftliche Macht verhindert, Effektivität und Produktivität fördert, Qualität steigert und Preise senkt.
Ich möchte ein zweites brisantes und umstrittenes Problem in der Linken aufgreifen, die berühmte Eigentumsfrage. Orthodoxe Marxistinnen und Marxisten gingen und gehen davon aus, mit der Enteignung der Eigentümerinnen und Eigentümer wären alle Fragen im Kern beantwortet, damit wäre die Machtfrage gelöst. Das Problem ist jedoch wesentlich komplizierter. Nehmen wir nur die riesigen US-Pensionsfonds. Anteilseigner sind die Beschäftigten in amerikanischen Unternehmen, die privat für ihre Alterssicherung aufkommen müssen. Sie sind selbst an möglichst hohen Renditen interessiert.
Die Verwalter dieser Fonds, die Finanzmakler und Analysten, spekulieren mit einem Teil dieser Rentenfonds, beteiligen sich auch an Hedge-Fonds, die auf der Jagd nach immer höheren Renditen im Zweifel sogar die Unternehmen ausschlachten, zerstückeln und Beschäftigte entlassen. Aus kurzfristigen Renditeinteressen werden also im Zweifelsfall die Existenzen von Unternehmen aufs Spiel gesetzt.
Das Problem ist dabei nicht die Eigentumsfrage, sondern die Frage der gesellschaftlichen Kontrolle und Teilhabe der Anteilseigner an den Rentenfonds, die sich gewiefter Fondsmanager bedienen und die Fonds für spekulative Transaktionen missbrauchen. Es geht also nicht einfach um Macht und Eigentum, sondern um die Inhalte von Macht und Eigentum.
In unserem Grundgesetz ist das Eigentum an das Gemeinwohl gebunden. Daran ließe sich anknüpfen. Eigentümerinnen- und Eigentümerinteressen müssten verpflichtet werden, sich an sozialen und ökologischen Standards zu orientieren. Dabei sollten die abhängig Beschäftigten und ihre Interessenvertretungen ein gewichtiges Wörtchen mitreden – mehr als es die heutige Mitbestimmung ermöglicht.
Trotzdem: Staatliches, kommunales und genossenschaftliches Eigentum bleiben in Schlüsselbereichen und in der öffentlichen Daseinsvorsorge wichtig, auch um sozial und ökologisch regulieren zu können und – wie gesagt – ein Primat der Politik und damit der Demokratie zu sichern.
Nun bleibt die Frage, ob ich hier einen Sozialismus skizziert habe. Innerhalb des so genannten »Analytischen Marxismus« nannten sich einige »Marktsozialisten«. So etwas in der Art diskutierte man auch dort. Dann gibt es die Wirtschaftsdemokratietheoretiker. Auch hier sehe ich Berührungspunkte. Aber ich würde vorschlagen, etwas weniger vollmundig einfach nur von einer Marktwirtschaft zu sprechen, die ihr Prädikat »sozial« wirklich einmal verdient hätte. Aber was hat das dann mit Sozialismus zu tun?
Der Kapitalismus kam nicht zu Stande, weil die Leute beschlossen hatten, dass sie Kapitalismus machten. Man kann entgegen früheren Hoffnungen nicht einfach etwas anderes beschließen, zumindest wird es dadurch noch nicht.
Ich hoffe, dass es unseren Gesellschaften gelingt, im Rahmen sozialer Lernprozesse sich so zu verändern, dass die emanzipativen Errungenschaften der bürgerlichen Ära bewahrt und ihre desaströsen Momente überwunden werden können. Das entspricht wohl ungefähr dem, was Marx sich unter einer sozialistischen Gesellschaft vorgestellt hat.
Hoffnung heißt aber nicht, dass es im Hier und Jetzt nichts zu tun gibt. Letztlich geschieht nur das, was die Menschen zulassen, dass es geschieht. Überall dort, wo wir Macht und Einfluss haben, etwas zu verändern, müssen wir auch den Mut haben, das zu tun. Wir müssen aber auch genügend Vorsicht walten lassen, damit die Richtung der Veränderung entweder stimmt oder zumindest schnell korrigierbar ist.
Unsere zukünftige Alternative jenseits dieser bestehenden Gesellschaftsordnung ist – um abschließend noch einmal Friedrich Engels zu zitieren – »nicht etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittels des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu entdecken«. Ich hoffe nur, dass uns angesichts der Zuspitzungen der sozialen, ökologischen und kriegerischen Herausforderungen noch genügend Zeit bleiben wird.Der Kapitalismus kam nicht zu Stande, weil die Leute beschlossen hatten, dass sie Kapitalismus machten. Man kann entgegen früheren Hoffnungen nicht einfach etwas anderes beschließen, zumindest wird es dadurch noch nicht.
Ich hoffe, dass es unseren Gesellschaften gelingt, im Rahmen sozialer Lernprozesse sich so zu verändern, dass die emanzipativen Errungenschaften der bürgerlichen Ära bewahrt und ihre desaströsen Momente überwunden werden können. Das entspricht wohl ungefähr dem, was Marx sich unter einer sozialistischen Gesellschaft vorgestellt hat.
Hoffnung heißt aber nicht, dass es im Hier und Jetzt nichts zu tun gibt. Letztlich geschieht nur das, was die Menschen zulassen, dass es geschieht. Überall dort, wo wir Macht und Einfluss haben, etwas zu verändern, müssen wir auch den Mut haben, das zu tun. Wir müssen aber auch genügend Vorsicht walten lassen, damit die Richtung der Veränderung entweder stimmt oder zumindest schnell korrigierbar ist.
Unsere zukünftige Alternative jenseits dieser bestehenden Gesellschaftsordnung ist – um abschließend noch einmal Friedrich Engels zu zitieren – »nicht etwa aus dem Kopfe zu erfinden, sondern vermittels des Kopfes in den vorliegenden materiellen Tatsachen der Produktion zu entdecken«.
Ich hoffe nur, dass uns angesichts der Zuspitzungen der sozialen, ökologischen und kriegerischen Herausforderungen noch genügend Zeit bleiben wird.
Gregor Gysi – Jg. 1948, Dr. jur., Dez. 1989-Jan. 1993 Vorsitzender der PDS, 1990 Vors. der PDS-Fraktion in der Volkskammer der DDR, 1990-2000 Vors. der PDSFraktion im Deutschen Bundestag, Jan.-Aug. 2002 Bürgermeister und Senator für Wirtschaft in Berlin, seit Okt. 2005 Vorsitzender der Fraktion DIE LINKE. im Deutschen Bundestag (gemeinsam mit Oskar Lafontaine).
Der hier gedruckte Text folgt einem Vortrag, den der Autor am 24. Januar 2007 an der Universität Marburg gehalten hat.
Randbemerkungen zum Text:
»Die Bundesrepublik Deutschland ist ein reiches Land. Allerdings sind die Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum und die Lebenschancen ungleich verteilt. Dabei gibt es neue und auch wachsende Möglichkeiten für ein Leben in Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden. Doch sie werden von zerstörerischen Prozessen blockiert. Diese sind Folge hochkonzentrierter Kapitalmacht, sie entstehen aus dem Vorrang der internationalen Finanzmärkte und dem Übergang der Herrschenden von einer Politik des sozialstaatlich regulierten Kapitalismus zu einer marktradikalen, neoliberalen Politik.« Programmatische Eckpunkte. Entwurf des programmatischen Gründungsdokuments der Partei DIE LINKE. (Beschluss der Vorstände von Linkspartei.PDS und WASG auf ihrer gemeinsamen Beratung am 10. Dezember 2006), Abschn. I: Gemeinsam für eine andere Politik, in: www.sozialisten.de.
»Unsere Alternative zu diesem entfesselten Kapitalismus ist die solidarische Erneuerung und konsequent demokratische Gestaltung der Gesellschaft. Die Vielfalt individueller Lebensentwürfe und das Aufbrechen traditioneller Rollen der Geschlechter begreifen wir als eine Chance für Individualitätsentfaltung, deren Basis es durch materielle und soziale Sicherheit kollektiv zu sichern gilt. Wir wenden uns gegen eine Politik des Forderns und Förderns, die Arbeitslosigkeit zum individuellen Problem erklärt. Stattdessen wirken wir für gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die Arbeit und Persönlichkeitsentwicklung für alle Menschen ermöglichen. Ein grundlegender Politikwechsel für eine sozial gerechtere Gesellschaft erfordert, die uralte Idee der Solidarität mit Antworten auf neue gesellschaftliche Herausforderungen zu verbinden.« Ebenda, Abschn. I: Gemeinsam für eine andere Politik.
»Wir wollen Grundideen alternativer Politik zusammenführen. Der Kampf gegen den Abbau sozialer Rechte, für eine gerechte Verteilung der Arbeit in einer humanisierten Arbeitswelt und für einen erneuerten solidarischen Sozialstaat ist der im Gründungsprogramm formulierte Ausgangspunkt der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Die Linkspartei.PDS bringt in Übereinstimmung damit ihr historisches Verständnis des demokratischen Sozialismus als Ziel, Weg und Wertesystem und als Einheit von Freiheits- und sozialen Grundrechten ein – niedergelegt in ihrem Chemnitzer Programm. Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität sind unsere grundlegenden Wertorientierungen. Sie sind untrennbar mit Frieden, Bewahrung der Natur und Emanzipation verbunden. Die Ideen des demokratischen Sozialismus stellen zentrale Leitvorstellungen für die Entwicklung der politischen Ziele der Linken dar.« Ebenda, Abschn. I: Gemeinsam für eine andere Politik.
»Der Neoliberalismus tritt im Namen von mehr Freiheit an, doch werden alle Lebensbereiche der Kapitalverwertung und insbesondere der Steigerung der Aktienkurse auf den Finanzmärkten unterworfen. Neoliberale Kräfte fordern weniger Staat und bauen den Sozialstaat zugunsten eines repressiven Wettbewerbsstaats ab. Sie berufen sich auf die Demokratie und versuchen, Gewerkschaften und andere demokratische Organisationen und Bewegungen zu schwächen. Sie verfolgen eine unsolidarische Politik der Privatisierung, Deregulierung und Unterordnung aller Lebenssphären unter die Märkte. Sie lösen neue imperiale Kriege aus und verschärfen die Terrorgefahren. Statt Chancengleichheit zu fördern, vergrößern sie die Kluft zwischen oben und unten. Niedriglohnsektoren breiten sich aus. Steigende Gewinne gehen einher mit anhaltender Massenarbeitslosigkeit. Große Teile der Bevölkerung wenden sich von der Teilnahme an der demokratischen Willensbildung ab.« Ebenda, Abschn. II: Eine andere Welt ist nötig.
»Neoliberaler Kapitalismus bedeutet Entdemokratisierung. Bei den internationalen Finanzfonds, trans-nationalen Konzernen und in den supranationalen Organisationen des globalen Kapitalismus – Welthandelsorganisation, internationaler Währungsfonds, Weltbank usw. – ist eine ungeheure Machtfülle konzentriert. Sie sind jeder demokratischen Kontrolle entzogen. Die Substanz der Demokratie wird ausgehöhlt. Mit dem proklamierten ›Krieg gegen den Terrorismus‹ wird eine massive Einschränkung von Grundund Freiheitsrechten gerechtfertigt. Es wird immer ungehemmter auch zu barbarischen Methoden der Herrschaft gegriffen.« Ebenda, Abschn. II: Eine andere Welt ist nötig.
»Mit der Europäischen Union ist ein neuer Raum für gemeinsame soziale Kämpfe, Bewegungen für Frieden und nachhaltiges Wirtschaften, für Demokratie und gegen Rassismus und Nationalismus, ein neuer Raum der Klassenkämpfe entstanden. In Europa sind die freie Bewegung des Kapitals, die Verlagerung von Produktionsstätten und die Wanderung von Arbeitskräften alltäglich. Der Zusammenschluss von Gewerkschaften, demokratischen Initiativen, der Friedens-, Frauen- und Umweltbewegung steht jedoch erst am Anfang.« Ebenda, Abschn. II: Eine andere Welt ist nötig.
»Wir streiten für eine Gesellschaft, die jede und jeden an den Bedingungen eines Lebens in Freiheit, sozialer Sicherheit und Solidarität beteiligt. Zu den Freiheitsgütern, die dies erst ermöglichen, gehören sie sozial gleiche Teilhabe der Einzelnen an den Entscheidungen in der Gesellschaft, existenzsichernde, sinnvolle Arbeit, Bildung und Kultur, hochwertige Gesundheitsleistungen und soziale Sicherungen. Notwendig ist die Überwindung aller Eigentums- und Herrschaftsverhältnisse, ›in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist‹ (Karl Marx).« Ebenda, Abschn. III: Unsere Alternative: Soziale, demokratische und friedensstiftende Reformen zur Überwindung des Kapitalismus.
»Noch herrscht der neoliberale Zeitgeist. Streiks gegen Arbeitsplatzabbau, Demonstrationen gegen die Agenda 2010 und Hartz IV sowie die Wahlerfolge der Linken zeigen, dass dies nicht so bleiben muss. Bürgerinnen und Bürger beginnen, sich zu wehren. Es ist die strategische Kernaufgabe der Linken, zur Veränderung der Kräfteverhältnisse als Voraussetzung für einen Richtungswechsel beizutragen. « Ebenda, Abschn. IV: Für einen Richtungswechsel.
»Wir setzen der neoliberalen Ideologie alternative Positionen eines alternativen Entwicklungsweges entgegen. Diese werden wir mit den Erfahrungen und Konflikten in den Betrieben und im Alltagsleben verknüpfen und in der öffentlichen Auseinandersetzung populär und offensiv vortragen. Die wirtschaftlichen und sozialen Probleme verstehen wir vor allem als Ergebnisse falscher, neoliberal geprägter Antworten auf die neuen Herausforderungen unter dem Einfluss von Kapitalinteressen sowie als Ausdruck von Krisenprozessen und Widersprüchen, die die kapitalistische Ökonomie hervorbringt. In der öffentlichen Debatte hebt DIE LINKE. den Widerspruch zwischen einzelwirtschaftlicher und gesamtgesellschaftlicher Perspektive hervor. Dringlich sind Aufklärung, Öffentlichkeitsarbeit und Aktionen, breit angelegte Bildungsarbeit, Bildung von Netzwerken und die Beteiligung an wissenschaftlichen Diskussionen.« Ebenda, Abschn. IV: Für einen Richtungswechsel.
»Wir wollen eine Welt schaffen, in der die Würde jeder und jedes Einzelnen wirklich unantastbar ist, in der soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Selbstbestimmung, Demokratie und Frieden vereint sind, in der die Menschen im Gleichklang mit der Natur leben. Dazu wirken wir für ein breites Reformbündnis. Gemeinsam streiten wir dafür, dass der Kapitalismus nicht das letzte Wort der Geschichte ist.« Ebenda, Abschn. IV: Für einen Richtungswechsel.
in: UTOPIE kreativ, H. 198 (April 2007), S. 309-327 309
Ein paar klärende Sätze
Ich muss nicht Verständnis aufbringen für die Sorgen und Ängste von Menschen, die offenbar zu kalt und gefühlsverarmt sind, um zu erkennen, welche Ängste ihre instinktlosen Demonstrationen bei Flüchtlingen und Einwanderern auslösen.
Ich muss nicht verstehen, warum viele Jahre nach dem Mauerfall – in nahezu ausländerfreien Zonen - Menschen gegen Ausländer auf die Straße gehen, nur weil sie nicht kapiert haben, womit Deutschland sein Geld und seinen Wohlstand verdient: mit Internationalität.
Ich muss nicht ertragen, dass eine Demonstrantin in Dresden in die Kamera spricht: “Wir sind nicht ’89 auf die Straße gegangen, damit die jetzt alle kommen” während sie so aussah, als sei sie ’89 nur auf die Straße gegangen, um bei ihrem Führungsoffizier die zu verpfeifen, die wirklich gingen. Diese Demonstrationen “Montagsdemonstrationen” zu nennen, ist eine weitere Instinktlosigkeit gegenüber denjenigen, die ’89 für Freiheit und offene Grenzen auf die Straße gingen.
Ich muss nicht akzeptieren, dass Menschen, die seit Jahrzehnten direkt und indirekt Transferleistungen in bisher ungekannten Höhen entgegengenommen haben, nun nicht einmal Flüchtlingskindern ein Dach über dem Kopf gönnen.
Ich muss nicht wie CSU und manche in der CDU die Fehler vor allem dieser beiden Parteien aus den 60er Jahrenbis heute wiederholen und diesen eiskalten Demonstranten auch noch verbale Zückerchen zuwerfen – von AfD und der anderen braunen Brut ganz zu schweigen.
Ich muss nicht christlich sein zu Menschen, die angeblich die christliche Tradition verteidigen, um dann ausgerechnet zur Weihnachtszeit Hass und Ausgrenzung zu predigen.
Ich muss nicht nach Ursachen suchen, um den niedersten Instinkt, zu dem die menschliche Rasse fähig ist, zu erkennen: Das Treten nach unten und das Abwälzen persönlicher Probleme und Unfähigkeiten auf willkürlich ausgewählte Sündenböcke.
Ich muss nicht ertragen, dass Menschen, die seit Jahren den Hintern nicht bewegt bekommen, ausgerechnet dann aktiv werden, wenn es gegen Minderheiten geht.
Ich muss nicht daran erinnern, dass die deutschen sozialen Sicherungssysteme in jedem Jahr Milliarden EUR netto durch Einwanderer und deren Nachfahren eingenommen haben – und dass diese Gelder am Ende dem Pöbel der gegen diese Menschen demonstriert auch noch die Rente zahlen werden.
Ich muss nicht diplomatisch sein, sondern so, wie noch viel mehr Menschen in Deutschland sein sollten, offensiv:
Braune Brut der AfD und Co: Ihr seid die Schande Deutschlands.
Unbarmherzig, hasserfüllt, menschenfeindlich und aus ganzem Herzen verachtenswert.
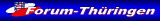 |
Welttaktgeber
Wer wissen will, wie diese Welt tickt.
|