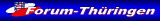Gastli - Texte und natürlich linksbündig
Hallo geschätzter Leser. Hier findet Ihr Texte einfach zu lang für jedes Forum, aber trotzdem lesenswert.
Meine Seite ist ab 18 Jahren, denn ab da kann man voraussetzen, dass der Mensch denkt...
...und ausserdem nicht mehr mit den Umtrieben der Deutschen Regierung gegen Websiten in Schwierigkeiten kommt, wenn er eine Internetseite wie diese lesen will.
Im Übrigen gilt Folgendes für die verlinkten Seiten:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten sind. Dieses kann – laut Landgerichtsurteil – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.
So bleibt hier vorsorglich festzustellen, dass ich weder Einfluss auf die Gestaltung noch auf den Inhalt dieser gelinkten Seiten haben und uns auch nicht dafür verantwortlich zeichnen. Dies gilt für ALLE auf dieser Seite vorhandenen Links.
Gewinn und Gesellschaft
Was man vielleicht doch über den Kapitalismus wissen sollte.
Von Georg Fülberth veröffentlicht in JW
Wer es eilig hat, kann die Frage, was Kapitalismus ist, mit einem einzigen Buchstaben, versehen mit einer Ergänzung, beantworten: G' oder, verbalisiert: G Strich.
Soll heißen: Kaufen Sie für Geld (gleich G) eine Ware (gleich W), veräußern Sie letztere wieder und erhalten Sie dafür mehr Geld als vorher (gleich G'), dann hat sich das ursprünglich eingesetzte Geld als Kapital erwiesen. Der Vorgang G – W – G' ist ein typischer Ablauf im Kapitalismus. Allerdings gehört auch noch eine Veränderung der Ware selbst hinzu: Sei es, daß sie zu einer anderen Ware umgeformt, sei es, daß sie von einem Ort zum anderen transportiert wird. Sie ist hinterher nicht mehr dieselbe: Aus W ist W' geworden, unsere Formel lautet jetzt: G – W – W' – G'.
Wer es gern noch etwas wortreicher hätte, kann den Kapitalismus auch so definieren: Kapitalismus ist die Funktionsweise von Gesellschaften, die auf der Erzielung von Gewinn und der Vermehrung (gleich Akkumulation) der hierfür eingesetzten Mittel (gleich Kapital) durch Produktion, Kauf und Verkauf von Waren oder die Erstellung und den Verkauf von Dienstleistungen beruhen.
Was wissen wir jetzt? Noch nicht sehr viel. Der Formel sieht man nämlich nicht an, ob sie eine Wirtschaftsweise oder ein Gesellschaftssystem bezeichnet. Das ist nicht ein und dasselbe.
Kapitalismus als den Vorgang G – W – W' – G' hat es bereits in der Antike, im Feudalismus und sogar im DDR-Sozialismus des »Neuen Ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft« gegeben – also in nichtkapitalistischen Systemen. Dort wurde Gewinn durch den Einsatz von Mitteln gemacht, die sich auf diese Weise vermehrten. Während des Mittelalters und in der frühen Neuzeit wurde auch in Japan, Indien, China und in der islamischen Welt so gewirtschaftet. Diese Kapitalismen waren aber immer nur Subsysteme in nichtkapitalistischen Gesellschaften.
Wenn Marx ausnahmsweise einmal das Wort »Kapitalismus« benutzt, meint er immer nur diese Wirtschaftstechnik (»Produktionsweise«), nicht ein Gesellschaftssystem. Erst Werner Sombart hat 1902 ganze Gesellschaften als »Kapitalismus« bezeichnet.
Der Unterschied läßt sich am allerersten Satz des Marxschen »Kapital« darstellen. Dort heißt es: »Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine ›ungeheure Warensammlung‹, die einzelne Ware als seine Elementarform.« 1
Was sehen wir hier? Antwort: eine Gesellschaft mit einem Inhalt. Dieser ist eine »kapitalistische Produktionsweise«, die zur Gesellschaft gehört, aber nicht notwendig mit dieser identisch ist. Als schierer Inhalt dieser Gesellschaft wäre die Produktionsweise nur ein Subsystem. Im eben gebrachten Zitat aber »herrscht« sie. In diesem Fall erst haben wir es allerdings mit »Kapitalismus« als Gesellschaftssystem zu tun. Der Ausdruck selber (Kapitalismus) aber wurde von Marx in diesem Zitat eben vermieden.
Noch einmal sei festgehalten: »Kapitalismus« kann entweder eine Produktionsweise innerhalb einer nichtkapitalistischen Gesellschaft, also ein Subsystem, sein oder selbst zum Gesellschaftssystem werden.
Wie entsteht der Gewinn?
Eine zentrale kapitalistische Tatsache ist der Gewinn. Er ist leicht zu definieren: als Überschuß des Ertrags über die Kosten. Schwerer ist die Frage zu beantworten, wo der Gewinn denn herkommt.
Als kleine Kinder haben wir alle wohl gemeint, der Kaufmann, bei dem man Drops oder Waffeln bekommt, schlage auf seinen Einkaufspreis eben noch etwas drauf und behalte es für sich, sei also eine Art Betrüger. Marx hat diese naive Auffassung immerhin so ernstgenommen, daß er es für nötig hielt, sie im ersten Band seines »Kapital« zu widerlegen:
In einer vollständigen Marktwirtschaft ist jeder Verkäufer auch wieder ein Käufer. Den Aufpreis, den er sich genehmigte, muß er irgendwann selbst wieder draufzahlen, wenn er bei seinen ehemaligen Käufern selbst etwas ersteht: Sie berechnen ihm ihre eigenen Kosten. In diese geht der Gewinn des Erstverkäufers ein und ist damit für den Schlaumeier, der sich einen Zuschlag genehmigte, doch wieder futsch.
Diese Widerlegung hat Marx wohl nur aus pädagogischen Gründen unternommen. Mit ihr wollte er zeigen, daß er eine viel leistungsfähigere Erklärung hatte: den Mehrwert. Er wird von den Lohnabhängigen in unbezahlter Arbeitszeit erwirtschaftet, nachdem sie zunächst den Lohn für ihre eigene Reproduktion erwirtschaftet haben. Im ersten Band des »Kapitals« ist das stimmig dargestellt. Allerdings ist der Wert der Waren hier nur nach deren Input: Arbeitszeit, ausgedrückt in Geld, dargestellt. Im dritten Band wird es schwierig: Hier muß dieser Input (Wert) in ein Verhältnis zu dem gesetzt werden, was außen auf den Waren tatsächlich draufsteht: dem Preis. Es ist Marx nicht gelungen, die Identität von beiden mathematisch einwandfrei darzustellen. Wird der Arbeitswert wackelig, ist es auch der Mehrwert.
Die Grenznutzenlehre mit ihren Angebots- und Nachfragekurven bietet allerdings noch weit weniger Antworten auf die Frage nach der Entstehung des Gewinns. Dort fällt dieser nur an, wenn die Nachfrage höher ist als das Angebot. In einer Wirtschaft, die sich im Gleichgewicht befindet, könnte es demnach keinen Gewinn geben.
Hier weiß Joseph A. Schumpeter (1882–1950) Abhilfe. Wenn ein schöpferischer Unternehmer durch eine Innovation – ein neues Produkt, ein neues Verfahren, anderes Marketing o. ä. – das bestehende Gleichgewicht zerstört, fällt ihm der sogenannte Unternehmergewinn zu. Im Gleichgewicht dagegen gibt es nur den Zins. Wo der herkommt, kann Schumpeter nicht erklären.
Einige werden noch auf die Monopole hinweisen. Diese erzielen aber nur einen Extragewinn durch Marktzugangsbeschränkung. Wer auf sie hinweist, kann nicht erklären, woher der »normale«, also der nichtmonopolistische Gewinn kommt und sieht sich deshalb entweder auf die Mehrwert- oder die Grenznutzenlehre verwiesen, die aber, wie gezeigt, keine ausreichende Antwort auf die Frage, wo der Gewinn denn herkommt, geben können.
Und hiermit scheinen wir am Ende mit unserem Latein. Der Kapitalismus erscheint auch insofern als eine pathologische Veranstaltung, als in ihm zwecks Gewinnerzielung gewirtschaftet wird, man aber offenbar keine Einigkeit darüber erreichen kann, wo dieser Gewinn herkommt. Eine plausible Lösung bietet Robert L. Heilbroner (1919–2005) an. In seinem Buch »The Nature and the Logic of Capitalism«2 riet er zu einem vernünftigen Eklektizismus, soll heißen: Sämtliche eben aufgeführte Gewinnquellen gibt es wirklich, der Fehler entsteht nur dann, wenn man eine von ihnen zur alleinigen erklärt.
Beginnen wir – erstens – mit dem »betrügerischen« Aufpreis. Marx hatte darauf hingewiesen, daß er bei universellem Tausch auf transparenten Märkten nicht möglich ist. Aber wo gibt es schon völlig transparente Märkte? Inzwischen sind Theorien über den unvollkommenen Wettbewerb entwickelt worden, die nachweisen, daß dieser die Regel ist. Auf vermachteten oder intransparenten Märkten ist der Aufpreis also möglich.
Zweitens: Wenn gegen die Marxsche Theorie vom Mehrwert eingewandt wird, der Gewinn beruhe nicht nur auf Arbeit, sondern auch auf dem Einsatz von Kapital, dann ist zu antworten, daß ohne Einsatz von Arbeit aus diesem Gewinn kein Profit herausgeschlagen werden kann und daß der Ertrag nur dann höher als der Einsatz ist, wenn die Reproduktionskosten für die Arbeitskraft geringer sind als der Preis des Produkts. Heilbroner empfiehlt überdies, den Mehrwert nicht ausschließlich an den Arbeitswert zu binden, aber dieser Überlegung wollen wir hier nicht weiter nachgehen.
Drittens: Die Lehre vom Grenznutzen trägt immerhin dann zur Erklärung des Profits bei, wenn der Markt eben nicht im Gleichgewicht ist. Das ist statistisch der Regelfall.
Viertens: Daß neue Produkte und Verfahren zu Sondergewinnen führen (Schumpeter), ist ebenso eine Erfahrungstatsache wie fünftens: der Monopolgewinn.
Es empfiehlt sich also eine multifaktorielle Gewinnerklärung statt einer monokausalen. Und doch gibt es einen letzten Grund, auf dem diese fünf Gewinnarten allesamt beruhen: das Privateigentum an den Produktions- und Zirkulationsmitteln und an den Waren. Wer seine Mitmenschen auf intransparenten Märkten übers Ohr hauen will, den Nachfrageüberhang nutzt, Lohnarbeit einsetzt oder einen Monopolgewinn einstreicht: Immer benötigt er Privateigentum, mit dessen Hilfe er produziert oder das er zum Kauf anbietet. Selbst der mittellose Erfinder, der mit einem neuen Produkt ein Vermögen macht (er ist selten), braucht neben seiner guten Idee noch etwas: Kredit. Das ist das Geldeigentum anderer Leute, die es ihm zwecks Vermehrung ihres Reichtums zur Verfügung stellen. Der Begriff der Ausbeutung ist mit dem Ensemble dieser fünf Gewinnerklärungen vereinbar: Immer verfügen die Eigentümer über Nichteigentümer.
So, das hätten wir geklärt. Heilbroner wirft übrigens noch eine Frage auf: Warum wollen Menschen überhaupt Gewinne erzielen und sind nicht mit dem zufrieden, was sie zum Leben brauchen? Man könnte antworten: Wer seinen materiellen Bedarf decken will, kann das umso besser, je reicher er (oder sie) ist. Den Reichtum kann man vermehren, wenn man auf Märkten besser abschneidet als seine Mitmenschen, also Gewinn macht. Gut und schön (oder schlecht und häßlich). Aber im Kapitalismus regiert ja nicht nur das Prinzip der Gewinnerzielung, sondern vor allem das der Gewinnmaximierung. Mit größtmöglicher Bedürfnisbefriedigung der Kapitalisten hat das dann nichts mehr zu tun, wenn diese mehr Profit einstreichen, als sie mit der heftigsten Prasserei verbrauchen können. Warum maximieren sie dann?
Eine mögliche Antwort könnte lauten: Das kommt vom Wettbewerb. Wer mehr Gewinn macht als die Konkurrenz, kann auf einen Teil davon verzichten, indem er (oder sie) zeitweilig die Preise senkt und damit seine Mitkapitalisten aus dem Markt wirft. Aber warum muß das sein? Neue Antwort: besser andere niederkonkurrieren, als selbst von ihnen kaputtgemacht zu werden. Angesichts der Konkurrenten erscheint aggressive Gewinnmaximierung da wie Notwehr – verkehrte Welt.
Diese Scherereien könnten sich die Kapitalisten vom Hals schaffen, indem sie Absprachen treffen, sich gegenseitig nicht weh tun zu wollen. Das ist in der Marktwirtschaft schwer verboten: Kartellbildung sei Wettbewerbsverzerrung. Daran ist soviel dran, daß unter solchen Absprachen in der Regel die Abnehmer leiden, und in der Mehrheit sind sie Nichtkapitalisten. Für ungezügelte Profitmaximierung im Wettbewerb könnte sprechen, daß sie doch immer wieder schöne Ergebnisse zeitigt: Erfindungen, Kostensenkung, Bedürfnisbefriedigung der Kundschaft durch den Zwang zur Erzeugung des besseren, billigeren und begehrteren Produkts. Diese Segnungen, so lehrte bereits Adam Smith, seien Resultate des Egoismus, der letztlich zum Gemeinwohl führt.
Jetzt müssen wir aufpassen, daß wir uns nicht im Kreis drehen. Es mag ja sein, daß der Egoismus solche schönen Blüten treibt. Bei Adam Smith war allerdings noch von Gewinnerzielung, nicht von -maximierung die Rede. Erstere könnte die individualistische Ausformung des Selbsterhaltungstriebs (den gibt es ja nun wirklich) zu Lasten anderer Menschen sein. Aber weshalb gleich maximieren? An dieser Stelle argumentiert Robert Heilbroner – er hat die Frage ja aufgeworfen und soll in dieser Angelegenheit deshalb auch das letzte Wort haben – nicht ökonomisch, sondern anthropologisch. In der ihm bekannten Menschheitsgeschichte sieht er den Trieb nach »power« (Macht), »dominance« (Herrschaft) und »prestige« (wie im Deutschen: Prestige) am Werk. Diese grauslichen Neigungen seien vor dem Kapitalismus mit unmittelbarer Gewaltanwendung durchgesetzt worden, jetzt aber realisieren sie sich durch den Markt.
Das klingt ja gar nicht gut. Heilbroners Beobachtung hat allerdings für die Geschichte der Ungleichheitsgesellschaften viel für sich. Doch gibt es diese Zustände erst seit etwa 5000 Jahren. Die Menschheit aber ist älter: ca. 1,8 Millionen Jahre. Was schließen wir daraus? Ja, was wohl?
Bevor wir vollends schwermütig werden oder uns einen alten Urkommunismus zusammenphantasieren, auf den nach dem Kapitalismus ein neuer, jetzt aber moderner Kommunismus folgt, wollen wir uns lieber einer anderen Frage zuwenden. Sie lautet: Was ist typischer für den Kapitalismus – der Gewinn oder die Akkumulation? Die Antwort lautet: die Akkumulation. Wenn Gewinne von den Kapitalisten vollständig konsumiert werden, hat diese Gesellschaft keine Dynamik. Wird aber ein Teil des Profits einbehalten und neu angelegt, dann dehnt sie sich ständig aus und ergreift immer neue Lebensbereiche. Vergleichen wir, um das zu erläutern, doch einmal das Jahr 1806 mit dem Jahr 2006.
1806: Kapitalismus gab es damals in der Produktion nur in der britischen Landwirtschaft, in der britischen und belgischen Textil- und Montanindustrie, sonst nirgends. Diese Einengung bestand sowohl territorial als auch den Branchen nach: nur in diesen drei Wirtschaftszweigen und in diesen beiden Ländern hatten wir Industriekapitalismus. Vorher gab es schon den Handelskapitalismus (seit ca. 1500). Gewinne, die dort gemacht wurden, flossen in die Industrie, die aber selbst um 1800 noch sehr beschränkt war.
Und jetzt wenden wir uns dem Jahr 2006 zu. Da haben wir den Kapitalismus nicht nur weltweit, sondern er hat inzwischen immer mehr Lebensbereiche erfaßt. Während er früher zum Beispiel in den Familienhaushalten nichts zu suchen hatte, weil die Hausfrau wusch, backte, kochte, webte, strickte, schneiderte, schrubbte und konservierte, finden wir jetzt dort kapitalistisch erzeugte Waren: Waschmaschine, Kühlschrank, Staubsauger, Tiefkühlkost und Konserven, Konfektionskleidung. Das heißt, mittlerweile ist Kapital, das vorher in Bergbau, Textilindustrie und Landwirtschaft akkumuliert wurde, in andere Zweige gesteckt worden: zunächst in den Transport (erst Eisenbahnen, dann Autos) und in die Chemie- und Elektroindustrie, dann in die Nahrungsmittelerzeugung, schließlich in Haushaltsgeräte. Und es entstanden Branchen, an die man vorher nie gedacht hatte, zum Beispiel die audiovisuellen Medien. Mit Gewinnerzielung allein wäre das nicht zu machen gewesen, Akkumulation mußte hinzukommen.
Akkumulation ist ein Prozeß, also Geschichte. Damit haben wir einen Anhaltspunkt, um die Geschichte des Kapitalismus zu schreiben. Doch genügt es dabei nicht, sich auf die Kapitalbewegungen zu beschränken. Es geht zugleich um die Geschichte einer Gesellschaft.
Gesellschaft – was ist das eigentlich?
Womit wir schon wieder bei einer heiklen Frage wären: Was ist das eigentlich, Gesellschaft? Da die Soziologen auf ihren Soziologentagen mittlerweile erklären, das wüßten sie auch nicht mehr so recht, müssen wir uns erneut eigene Gedanken machen. Glücklicherweise gibt es einleuchtende Überlegungen von Lars Lambrecht, Margarete Tjaden-Steinhauer und Karl Hermann Tjaden, denen wir folgen können, wenn wir uns hoffentlich auf folgende Definition einigen: »Gesellschaft ist das Zusammenwirken von Menschen 1. zur Sicherung ihres Lebensunterhalts, 2. zum Unterhalt der noch nicht oder nicht mehr zur Sicherung des Lebensunterhalts befähigten Generationen und 3. zur Reproduktion und Sicherung ihrer territorialen Lebensvoraussetzungen.«3
Einige werden eine weitere Dimension vermissen: das Bewußtsein und die affektiven Beziehungen in Subsistenz, Familie und Politik. Da muß tatsächlich noch weiter gearbeitet werden, und man darf zuversichtlich sein, daß die Kasseler Arbeitsgruppe, die seit Jahren schon hervorragende »Studien zu Subsistenz, Familie und Politik« vorlegt4, uns auch hier in absehbarer Zeit auf die Sprünge helfen wird. Vorerst aber beschränken wir uns auf die hier genannten drei Bereiche. Sie geben uns immerhin Kriterien an die Hand, die wir brauchen, wenn wir Geschichte schreiben wollen, und das ist nötig. Mittlerweile sind nämlich nicht nur die Soziologen desertiert, sondern auch die Historiker: Viele von ihnen erzählen uns, sie wüßten nicht mehr, was Geschichte ist; und die es zu wissen meinen, reden durcheinander.
Akkumulation und Geschichte
Was ist Geschichte? Wir sollten erstens immer fragen, wie die Menschen einer gegebenen Zeit die Mittel zur Sicherung ihres Lebensunterhalts gewinnen. Um dies zu wissen, sollte man Aufschluß über die stofflichen und technologischen Grundlagen ihres Wirtschaftens zu erhalten versuchen. Als »technologische Grundlagen« sollen dabei diejenigen Verfahren gelten, die in einer gegebenen Periode typisch sind, nicht aber diejenigen, die sehr avanciert sind, jedoch in der Regel noch nicht angewandt werden. Hierfür ein Beispiel: Obwohl die Prinzipien der Verwendung von Dampfkraft um 1700 einigen Technikern schon bekannt waren, sind sie erst im 19. Jahrhundert für Produktion und Transport typisch geworden.
Zweitens fragen wir nach der jeweiligen Eigentums- oder – was dasselbe ist – Sozialstruktur. Eine Gruppe von Menschen, die über dieselbe Art von Eigentum verfügt, nennen wir: Klasse. Menschen, die ihren Lebensunterhalt hauptsächlich aus dem Eigentum an Kapital beziehen, gehören somit zur Kapitalistenklasse (französisch: Bourgeoisie); wer überwiegend von Lohn lebt, wird zur Arbeiterklasse gerechnet. Andere Klassen müssen nach dem gleichen Kriterium – Eigentum oder Nichteigentum an Produktionsmitteln – bestimmt werden.
Drittens sollten wir etwas über die gesellschaftliche Art und Weise wissen, wie innerhalb des Geschlechter- und Generationenverhältnisses die Nachkommenschaft erzeugt und aufgezogen wird und wie das Verhältnis der wirtschaftlich aktiven Generation zur noch lebenden älteren sich gestaltet. Ein Ensemble dieser Beziehungen – es muß nicht das einzige sein – nennen wir Familie. Wird als ihre Funktion für die Gesellschaft die Erzeugung und Konditionierung von neuen Gesellschaftsmitgliedern (unter anderem: Arbeitskräften) verstanden, so mag manchen eine solche Definition zynisch oder trivial erscheinen: eine Aufgabe scheint zu fehlen – die Sorge für die nicht mehr Arbeitsfähigen. Umso mehr verdient die konkret-historische Ausgestaltung des Inter-Generationenverhältnisses Interesse.
Viertens ist das räumliche Arrangement einer Gesellschaft zu bedenken, einschließlich der Art Weise und der Institutionen, in denen gemeinsame oder antagonistische Interessen wahrgenommen werden. Dies ist der Bereich der Politik im engeren Sinn, auch des Staates.
Fünftens sollten wir uns für etwaige Gegenbewegungen gegen die jeweilige gesellschaftliche Ordnung oder einzelne ihrer Varianten interessieren. Dieses fünfte Kriterium habe ich allerdings eingeschmuggelt, damit auch ein bißchen Opposition vorkommt. Allerdings stoßen wir dabei auch auf Bedenkliches: nicht jede Gegenbewegung ist links. Es gibt auch rechte Oppositionen gegen jeweils aktuelle Formen des Kapitalismus. Hierzu gehören Antisemitismus und Faschismus – dort, wo letzterer nicht an der Macht ist –, politischer Minderheitskatholizismus und religiöser Fundamentalismus – ebenfalls dann, wenn sie nicht schon (oder noch) einen Staat beherrschen. Auch der Neoliberalismus war eine Gegenbewegung, solange der Keynesianismus dominierte.
Eine sechste Tatsache kann – wie bereits eingestanden – gegenwärtig noch nicht adäquat behandelt werden: das durch die vier anderen bedingte, aber auch auf sie einwirkende Bewußtsein in seinen verschienen Formen. Sein Fehlen ist ein einzugestehender Mangel dieses Konzepts. Doch nur ein Betrüger gibt mehr, als er hat: Ein Ausweichen auf die von Historikern durchaus angebotenen modischen Mentalitätsgeschichten bringt nichts, da sie in der Regel ohne Zusammenhang mit den fünf anderen Kriterien bleiben.
Schreiben wir die Geschichte des Kapitalismus, werden wir natürlich unsere kitzlige Frage nach der Entstehung des Gewinns im Auge behalten, und siehe da: sie kann dann leichter beantwortet werden. Wir werden feststellen, daß in den verschiedenen Phasen auch jeweils unterschiedliche Gewinnformen stärker oder schwächer in die Erscheinung treten.
Sauseschritt durch die Jahrhunderte
Legen wir also los. Es stellt sich heraus, daß der Kapitalismus in seiner Geschichte bisher sieben Perioden durchlaufen hat (und weiterhin durchläuft: Es werden künftig wohl noch mehr werden). Beginnen wir – erstens – mit dem Handelskapitalismus (1500 bis ca. 1780). Die überwiegende Art von Kapital war das Kaufmannskapital mit seinen beiden Unterformen: dem Warenhandlungskapital und dem Geldhandlungskapital. Die typische Form des Gewinns wurde der Handelsgewinn auf intransparenten Märkten. Eine Minderheitsbedeutung hatte der Mehrwert in direkter (Großhandwerk, Manufaktur) und indirekter (Verlag) Form. Da Lohnarbeit noch keine prägende Tatsache war, gab es Anwendung von Kapital im wesentlichen zwar in der Zirkulationssphäre, aber nur untergeordnet in der Produktion selbst: der Kapitalismus hatte die Erzeugung noch nicht durchgehend erfaßt. In den Worten von Karl Marx: Es handelte sich um »die bloß formelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital«1.
Die stoffliche Grundlage war im Vergleich zum vorangegangenen Feudalismus nahezu unverändert, mit zwei Ausnahmen: Verbesserung der Hochseeschifffahrt und eine revolutionäre Umwälzung der Waffentechnik. In seiner Sozialstruktur ist der Handelskapitalismus regional verschieden:
– östlich der Elbe Gutsherren und Leibeigene,
–
– in Großbritannien Landlords, kapitalistische Pächter, Verlags- und Handelsbourgeoisie sowie Lohnarbeiter,
– Verlags- und Handelsbourgeoisie und Lohnarbeiter in den Niederlanden,
– Sklavenhalter und Sklaven in den Kolonien, vor allem Amerika.
Im regionalen Arrangement bildet sich ein Gegensatz zwischen kontinentalem Absolutismus und quasi-republikanischen Seestaaten (Großbritannien, Niederlande).
Zweitens: In der Industriellen Revolution (in Großbritannien und Belgien: 1780–1850; in Kontinental- und Westeuropa: 1830–1870; kurz darauf: USA; danach Japan – bis 1920 – und, steckenbleibend, Rußland) ändert sich die technologische Basis des Kapitalismus: anfangs leistungsfähigere Maschinen zur Textilerzeugung, dann die Dampfmaschine. Territorial erweitert sich diese Produktionsweise jetzt auf das europäische Festland und die Vereinigten Staaten von Amerika. Die Klassenscheidung in Bourgeoisie und Proletariat prägt die Sozialstruktur, Arbeitsmehrwert ist die hervorstechende Form von Gewinnerzielung. Da Marx in dieser Periode schreibt, ist dieser Aspekt bei ihm besonders scharf herausgearbeitet. Jetzt beginnen die Wirtschaftszyklen. Die moderne Arbeiterbewegung entsteht. Das territoriale Arrangement ist durch die Hegemonie Großbritanniens bestimmt.
Organisierter Kapitalismus und Imperialismus sind die beiden Merkmale der nächsten, der dritten Periode (ca. 1870–1914). Neben die Dampfkraft tritt die Elektrizität, in den USA auch schon der Verbrennungsmotor. Nun gehört auch die Chemieindustrie zu den dominanten Industrien. (Zusammengefaßt sprechen wir von der Zweiten Industriellen Revolution.) In vielen Ländern beginnt der Staat regulierend in Teile der Wirtschaft einzugreifen, auch durch Sozialgesetze. Das territoriale Arrangement entwickelt sich zum Imperialismus. Die britische Hegemonie wird durch zwei aufholende Mächte angefochten: Deutschland und die USA. Neben den Mehrwert und den Handelsgewinn treten Innovations- und Monopolprofit, auch wieder verstärkt koloniale Ausbeutung wie nach 1500 zu Beginn der handelskapitalistischen Phase. Sehr vielfältig sind nun die – rechten wie linken – Gegenbewegungen: 1. Arbeiterbewegungen, 2. Bewegungen für die Rechte der Frauen, 3. Freihandelsopposition, 4. radikaldemokratische Bewegungen, 5. anti-moderne Bewegungen, 6. Antisemitismus, 7. Bewegungen der kulturellen Differenz, 8. Religiöse Opposition, 9. nationalistische Oppositionsbewegungen, 10. Friedensbewegungen, 11. Pan-Bewegungen, 12. Antikoloniale Bewegungen.
Vierte Periode: die Zeit der Kriege und Krisen (1914–1945). Neben die nun voll ausgebildeten fünf Profitformen treten Ausplünderung unterworfener Staaten durch den deutschen Faschismus und Zwangsarbeit. Die britische Hegemonie endet, die US-amerikanische hat noch nicht begonnen. Die Gegenbewegungen der Periode vor 1914 radikalisieren und polarisieren sich. Ab 1917 gibt es eine antikapitalistische Gegenwelt: in Sowjetrußland. Die stoffliche Basis erweitert sich durch die Automobilindustrie.
In der fünften Periode (1945–1973) gewinnen, was die materielle Basis angeht, die Kunststoffe und Atomkraft wachsende Bedeutung. Sie ist durch den Systemkonflikt zwischen Kapitalismus und Sozialismus, die Befreiungskämpfe der bisherigen Kolonien und Halbkolonien sowie in den am weitesten entwickelten kapitalistischen Staaten durch ein relativ hohes Maß an Sozialstaatlichkeit gekennzeichnet. Vielleicht haben wir damals auch im Westen zwischenzeitlich im Sozialismus gelebt, ohne daß wir Trottel es gemerkt hätten. Um so etwas zu behaupten, sollten wir vorher aber aufschreiben, was wir unter Sozialismus verstehen. Bitte schön: Sozialismus ist die Verfügung einer Gesellschaft über die Produktionsmittel durch den planenden, organisierenden und verteilenden Einsatz von politischen Institutionen. Ein Unterfall ist das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln. Strukturiert dieses die gesamte Gesellschaft, wird sie in der Regel als kommunistisch bezeichnet. Die politischen Formen, in denen sozialistische Gesellschaften ihre Verfügung über die Produktionsmittel wahrnehmen, können sehr verschieden sein: von zahlreichen Varianten der Demokratie bis zur Despotie. Zumindest für Skandinavien und Teile Westeuropas kann, bezogen auf diese Zeit, gesagt werden, daß damals so viel Sozialismus herrschte, wie im Kapitalismus halt möglich ist. Aber so richtig Spaß machte das dann doch nicht, denn man lebte in permanenter Angst vor einem finalen Atomkrieg.
Die Intelligenz wird in den Metropolen zur Massenschicht und spielt sich in den Metropolen zeitweilig als Gegenbewegung auf. Der Klassenkampf zwischen Arbeit und Kapital nahm dort einen zähen, ökonomisch sehr wirksamen Charakter an: Vollbeschäftigung gab den Gewerkschaften große Verhandlungsmacht, ohne daß gleich gestreikt werden mußte. Die hochmonopolisierten Unternehmen behielten aber die Preissetzungsmacht. Als Ende der sechziger Jahre dadurch die Inflation zunahm, wurden die Geldvermögensbesitzer nervös. Nach dem Zusammenbruch des bisherigen internationalen Währungssystems 1973 und dem Übergang der Zentralbanken zu einer (»monetaristischen«) scharfen Beschränkung der Geldmenge konnten sie aufatmen, denn es begann:
Sechstens der Neoliberalismus. Zählen wir seine Hauptmerkmale kurz auf:
1. Die dritte Industrielle Revolution: Durchsetzung der Informationstechnologie in Produktion und Kommunikation,
2. Ende der Systemauseinandersetzung mit dem sowjetischen Sozialismus seit 1989. Damit hat der Kapitalismus, wie bereits vor 1917, keine politisch gesetzte territoriale Grenze mehr;
3. Schwächung der Investitions- und Regulierungstätigkeit der öffentlichen Hände (Staat, Gemeinden und gesetzlich definierte soziale Sicherungssysteme),
4. gesteigerte Bedeutung der internationalen Finanzmärkte: der Kapitalismus wird zum finanzmarktgetriebenen Kapitalismus,
5. Internationalisierung der Produktion,
6. Ausweitung der transnationalen Investitionen,
7. Ausdehnung und Beschleunigung des internationalen Warenverkehrs.
Beginn einer neuen Periode
Da haben wir den Salat.
Und jetzt?
Das, was man so Neoliberalismus nennt, ist aber auch schon wieder über dreißig Jahre alt. Es wird also Zeit, nach dem Beginn einer neuen Periode zu suchen, die ihn allerdings nicht beendet, sondern mit neuen Charakteristiken fortsetzt. Nennen wir diesen Zustand den »(potentiell und vielleicht nur vorübergehend) polyzentrische Kapitalismus (2001 ff.)«. Dies ist ein geschraubter und komplizierter Titel. Darin drückt sich aus, daß es sich nur um eine Hypothese über einen aktuellen Prozeß handelt, über den noch nicht abschließend befunden werden kann.
So sinnvoll es erscheinen mag, den Durchbruch des neoliberalen Kapitalismus ab 1974 zu datieren, so wenig einleuchtend wäre es, bereits jetzt sein Ende bestimmen zu wollen. Allerdings kann er nicht als eine einheitliche Periode aufgefaßt werden. Innenpolitisch haben wir es mit einem Kontinuum von Deregulierungsversuchen zu tun. Außenpolitisch – also im räumlichen Arrangement – wird mit der Jahrtausendwende ein Einschnitt sichtbar. Auch dem Ende der sozialistischen Gegenwelt seit 1989 kommt eine solche Bedeutung zu, ebenso der ständigen Erleichterung des internationalen Kapital- und Güterverkehrs schon seit den siebziger Jahren. Neu aber sind ab ca. 2001:
1. Krisenhafte Auseinandersetzungen um die Energiebasis. Die Ölkrisen von 1973 und 1979 hatten gezeigt, wie die konjunkturelle Entwicklung in den am höchsten entwickelten kapitalistischen Gesellschaften durch die Versorgung mit Mineralöl zwar nicht gesteuert wurde, aber ohnehin anbrechende zyklische Abschwungphasen durch Engpässe vertieft worden sind. Dies veranlaßte die Suche nach neuen Energiequellen. Die Hoffnung, daß dies die Atomkraft sein könne, war in den fünfziger und sechziger Jahren weithin Konsens gewesen. Etwa zeitgleich mit der ersten Ölkrise wurden ihre Perspektiven insbesondere angesichts der Tatsache, daß die Endlagerung der Brennelemente problematisch ist, kontrovers diskutiert. Sonnenenergie, die Gewinnung pflanzlicher Energie (Bioenergie), Windkraft – Sammelbegriff: Erneuerbare Energien – und Techniken der Energieeinsparung gewannen an Akzeptanz, doch ihr Ertrag ermöglichte noch nicht die Ablösung der fossilen Stoffe und der Kernkraft. Es handelt sich um eine Krise der stofflichen Basis, die vorderhand noch nicht technisch gelöst wurde: Die vorhandenen wissenschaftlichen und ingenieurtechnischen Kenntnisse würden wahrscheinlich ausreichen, doch kommen die ökonomischen und politischen Entscheidungen diesen Möglichkeiten entweder gar nicht oder nur langsam nach. Gleiches gilt für die Vermeidung eines ungesteuerten anthropogenen Klimawandels. Politik und Ökonomie verbleiben mehrheitlich bei konventionellen Reaktionen: forcierte Nutzung fossiler Energien und der Atomkraft. Hinzu kommen Versuche, durch eine neue Hochtechnologie eine Bindung an entweder fossile oder regenerierbare Energiequellen zu vermeiden (vielleicht durch Kernfusion). Hier wurde noch kein Durchbruch erzielt. Die Außenpolitik der USA spätestens seit dem Golfkrieg von 1991 ist offenbar in erheblichem Maße von dem Bestreben mitbestimmt, ihre Erdölzufuhr langfristig zu sichern. Mit dem »Krieg gegen den Terror« nach dem islamistischen Anschlag auf das World Trade Center 2001 ist dieser Kurs forciert worden.
2. Innerkapitalistische Hegemoniekonflikte. Das territoriale Arrangement in Europa folgt offenbar ebenfalls zumindest teilweise energiepolitischen Kalkülen, insbesondere in der Beziehung zwischen der EU und Rußland. Damit ist auch eine der Ursachen für innerkapitalistische Hegemoniekonflikte benannt, die seit 2001 deutlicher hervortreten: Spannungen zwischen den USA einerseits, Teilen der EU, Rußland und China andererseits.
3. Einen neuen Faktor stellen nachkoloniale (Indien, Lateinamerika) und ehemals sozialistische Gesellschaften dar, die als Exporteure, Rohstofflieferanten und -nachfrager nicht länger sei es Objekte, sei es Kontrahenten der alten kapitalistischen Metropolen sind. Mochte nach 1989 der Bereich der ehemaligen sozialistischen Gegenwelt zunächst nur durch seine Niederlage gekennzeichnet sein, so erweisen sich zumindest China und – in geringerem Maße – Rußland spätestens seit der Jahrtausendwende als eigenständige und starke kapitalistische Akteure (was auch dann gültig wäre, wenn man bereit wäre, den chinesischen Kapitalismus vorerst eher noch als ein – wenngleich sehr vitales – Subsystem, eine Wirtschaftsweise innerhalb einer noch nicht vollständig kapitalistischen Gesellschaft zu verstehen). Ebenso sind Argentinien, Brasilien, Chile, Venezuela (in abgestufter Weise auch andere Länder Lateinamerikas), Indien, Südafrika, Südkorea entweder dauerhaft oder zeitweilig aktive kapitalistische Mächte mit einem Status, den sie ökonomisch erst seit ca. der Jahrtausendwende in dieser Deutlichkeit wahrgenommen haben. Dieser ist mit dem traditionellen Begriff »Schwellenland« nicht mehr hinreichend charakterisiert.
Frage für die Hauptamtlichen
In der bipolaren Weltordnung 1945–1991 waren die USA die Führungsmacht des kapitalistischen »Westens«, auch wenn – rein ökonomisch gesehen – von einer »Triade« (Vereinigte Staaten, Westeuropa, Japan) gesprochen werden konnte. Mit der Durchsetzung des Kapitalismus (zumindest als Wirtschaftsweise) in China, dem ökonomischen Aufstieg Indiens und mehrerer lateinamerikanischer Länder sowie angesichts politischer Verselbständigungstendenzen in Europa ist die Zentralstellung der USA zumindest weniger deutlich als zuvor. Es könnte sein, daß seit Anfang des dritten Jahrtausends eine Übergangsperiode begonnen hat, in der zumindest zeitweilig das Verhältnis von Metropole, Semiperipherie, Peripherie und Außenarena durch eine Art Polyzentrismus wenn nicht ersetzt, so doch unterlegt ist. Ähnliche Phasen gab es im 18. Jahrhundert während der Konkurrenz Frankreich–Großbritannien, 1870–1945 in den Beziehungen zwischen Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA. Die aktuellen Akteure könnten sein: China, Indien, Lateinamerika, Japan, Europa und die USA. Das Übergewicht der Vereinigten Staaten besteht noch, könnte aber der Tendenz nach angefochten werden. Möglich ist auch, daß es sich neu festigt.
4. Die Entkoppelung von Finanz-, Güter- und Arbeitsmärkten hatte bereits 1973 mit dem Ende des Systems von Bretton Woods begonnen. Jetzt aber zeigte sich, daß sie sich strukturell verfestigt hatte. Mögliche Änderungen wären: Zusammenbruch dieser Märkte (oder auch nur eines einzigen von ihnen: des Arbeitsmarktes, genauer: seiner ständigen Einengung), neuer Protektionismus oder die Errichtung einer internationalen keynesianischen Finanzarchitektur.
Diese vier Momente könnten innerhalb der weiter bestehenden neoliberalen Phase des Kapitalismus zu einer neuen Entwicklung führen, die entweder durch verschärfte Verteilungskämpfe um eine im wesentlichen unveränderte Technologiebasis oder durch deren vollständige Umgestaltung charakterisiert ist. Dies wäre dann ein »Ende des Kapitalismus, wie wir ihn bisher kannten«2 – doch dies gilt für alle früheren tiefen Einschnitte in seiner Geschichte seit 1500 ebenso.
Somit kommen wir zu einer letzten Frage: Wann wird der Kapitalismus jemals enden?
Die Lösung dieses Problems überlassen wir mal lieber den Hauptamtlichen.
Quellenverzeichnis:
1 Marx, Karl: Das Kapital. Kritik der Politischen Ökonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprozeß des Kapitals. (=Marx, Karl, und Friedrich Engels: Werke. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED[MEW] Band 23) Berlin 1975, S. 533.
2 Altvater, Elmar: Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskritik. Münster 2005.
Literatur
- Fülberth, Georg: G Strich. Kleine Geschichte des Kapitalismus. Dritte Auflage. Köln: PapyRossa Verlag 2005.
- Lambrecht, Lars/ Karl Hermann Tjaden/ Margarete Tjaden-Steinhauer: Gesellschaft von Olduvai bis Uruk. Soziologische Exkursionen. Kassel 1998.
- Sperling, Urte/Margarete Tjaden-Steinhauer (Hrsg.): Gesellschaft von Tikal bis irgendwo. Europäische Gewaltherrschaft, gesellschaftliche Umbrüche, Ungleichheitsgesellschaften neben der Spur. Beiträge von Rolf Czeskleba-Dupont, Karl-Rainer Fabig, Lars Lambrecht, Thomas Mies, Bernd Reef, Urte Sperling, Karl-Hermann Tjaden, Margarete Tjaden-Steinhauer. Kassel 2004.
- Tjaden-Steinhauer, Margarete, und Karl Hermann Tjaden: Gesellschaft von Rom bis Ffm. Ungleichheitsverhältnisse in Westeuropa und die iberischen Eigenwege. Mit einer Diskussion von Frigga Haug, Lars Lambrecht, Margarete Tjaden-Steinhauer und Karl Hermann Tjaden über Anfänge gesellschaftlicher Ungleichheit. Kassel 2001.
Ein paar klärende Sätze
Ich muss nicht Verständnis aufbringen für die Sorgen und Ängste von Menschen, die offenbar zu kalt und gefühlsverarmt sind, um zu erkennen, welche Ängste ihre instinktlosen Demonstrationen bei Flüchtlingen und Einwanderern auslösen.
Ich muss nicht verstehen, warum viele Jahre nach dem Mauerfall – in nahezu ausländerfreien Zonen - Menschen gegen Ausländer auf die Straße gehen, nur weil sie nicht kapiert haben, womit Deutschland sein Geld und seinen Wohlstand verdient: mit Internationalität.
Ich muss nicht ertragen, dass eine Demonstrantin in Dresden in die Kamera spricht: “Wir sind nicht ’89 auf die Straße gegangen, damit die jetzt alle kommen” während sie so aussah, als sei sie ’89 nur auf die Straße gegangen, um bei ihrem Führungsoffizier die zu verpfeifen, die wirklich gingen. Diese Demonstrationen “Montagsdemonstrationen” zu nennen, ist eine weitere Instinktlosigkeit gegenüber denjenigen, die ’89 für Freiheit und offene Grenzen auf die Straße gingen.
Ich muss nicht akzeptieren, dass Menschen, die seit Jahrzehnten direkt und indirekt Transferleistungen in bisher ungekannten Höhen entgegengenommen haben, nun nicht einmal Flüchtlingskindern ein Dach über dem Kopf gönnen.
Ich muss nicht wie CSU und manche in der CDU die Fehler vor allem dieser beiden Parteien aus den 60er Jahrenbis heute wiederholen und diesen eiskalten Demonstranten auch noch verbale Zückerchen zuwerfen – von AfD und der anderen braunen Brut ganz zu schweigen.
Ich muss nicht christlich sein zu Menschen, die angeblich die christliche Tradition verteidigen, um dann ausgerechnet zur Weihnachtszeit Hass und Ausgrenzung zu predigen.
Ich muss nicht nach Ursachen suchen, um den niedersten Instinkt, zu dem die menschliche Rasse fähig ist, zu erkennen: Das Treten nach unten und das Abwälzen persönlicher Probleme und Unfähigkeiten auf willkürlich ausgewählte Sündenböcke.
Ich muss nicht ertragen, dass Menschen, die seit Jahren den Hintern nicht bewegt bekommen, ausgerechnet dann aktiv werden, wenn es gegen Minderheiten geht.
Ich muss nicht daran erinnern, dass die deutschen sozialen Sicherungssysteme in jedem Jahr Milliarden EUR netto durch Einwanderer und deren Nachfahren eingenommen haben – und dass diese Gelder am Ende dem Pöbel der gegen diese Menschen demonstriert auch noch die Rente zahlen werden.
Ich muss nicht diplomatisch sein, sondern so, wie noch viel mehr Menschen in Deutschland sein sollten, offensiv:
Braune Brut der AfD und Co: Ihr seid die Schande Deutschlands.
Unbarmherzig, hasserfüllt, menschenfeindlich und aus ganzem Herzen verachtenswert.
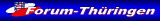 |
Welttaktgeber
Wer wissen will, wie diese Welt tickt.
|